Die Debatte um Julia Ruhs und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zeigt: Zuschreibungen wie „linksgrün versifft“ sagen oft mehr über die Kritiker als über die Sender. In meinem neuen Beitrag geht es nicht um Personen- und Institutionenschelte, sondern um die Frage, wie politische Zuschreibungen entstehen — und was sie über unsere Medienlandschaft verraten.
Sind Journalisten grün – oder ist das nur die Brille?
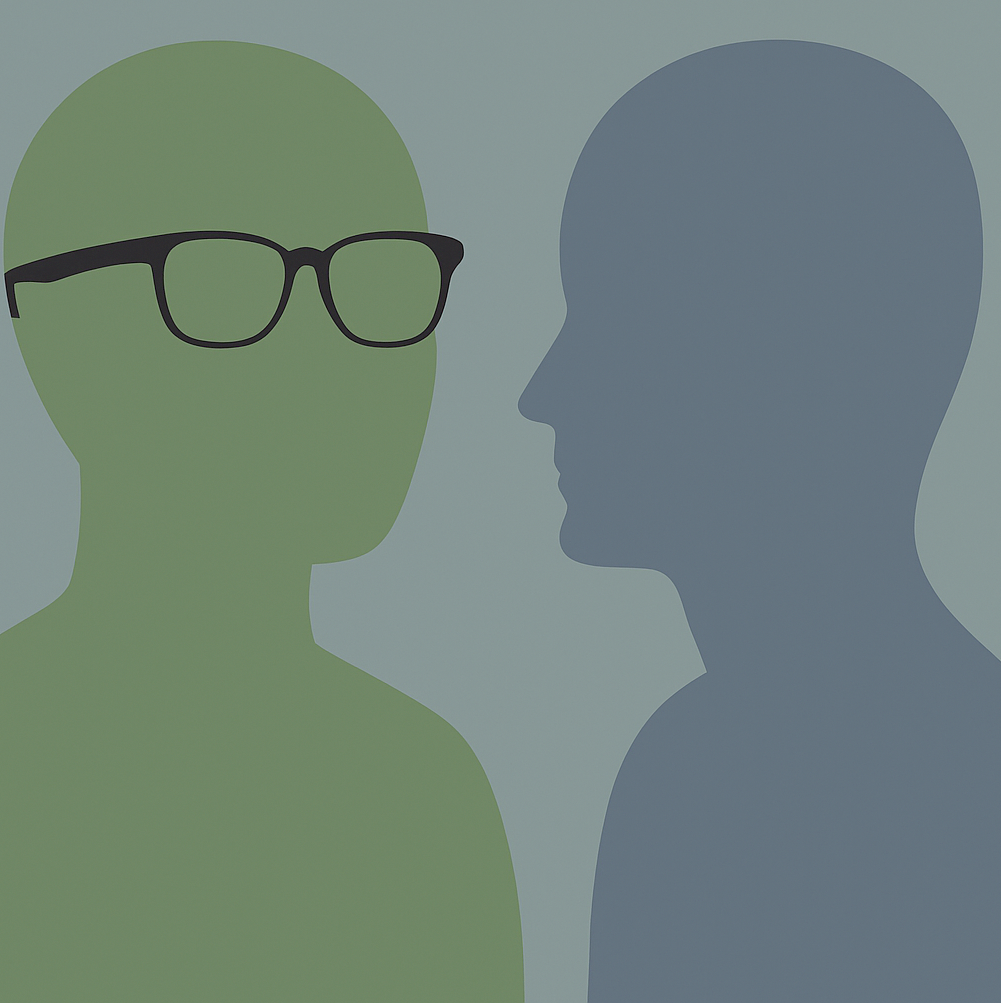
Zur politischen Zuschreibung im Medienbetrieb
Die Debatte um Julia Ruhs, das Format Klar und die angebliche „linksgrüne Versiffung“ des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist nur die jüngste Welle eines alten Narrativs. Neu ist allenfalls die Intensität, mit der politische Zuschreibungen heute nicht nur Inhalte, sondern auch Berufsgruppen betreffen.
Vor kurzem kursierte eine Erhebung, wonach ein signifikanter Anteil deutscher Journalisten bei den Grünen verortet sei. Die Zahl wurde rasch zum Beleg für eine angebliche Schlagseite im Medienbetrieb. Doch was sagt sie wirklich?
Henne oder Ei?
Sind Journalisten grün, weil sie Journalisten sind — oder sind sie Journalisten, weil sie grün sind?
Wer sich für gesellschaftliche Fragen interessiert, landet oft im Journalismus. Wer sich für ökologische, soziale oder progressive Themen engagiert, findet dort Resonanz. Aber das sagt nichts über die journalistische Praxis, die sich an Recherche, Quellenkritik und Differenzierung messen lassen muss. Der Anspruch professionellen Journalismus ist schlicht journalistische Qualität.
Der ÖRR als Projektionsfläche
Die Behauptung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei „linksgrün versifft“, ist ein rhetorisches Kampfmittel, kein analytisches Urteil. Schon in den 1980ern galt der WDR als „Rotfunk“. Heute sind es Formate wie Klar, die als Beleg und angebliches Korrektiv für konservative Unterrepräsentation herhalten müssen. Doch wer regelmäßig ÖRR-Talkshows und andere Formate verfolgt, in denen Vertreter von Rechtsaußen-Positionen und selbsternannte „konservative“ Philosophen prominent platziert werden, erkennt: Der ÖRR ist kein Monolith, sondern ein Spiegel gesellschaftlicher Spannungen.
Mission statt Moderation
Die Debatte um Julia Ruhs zeigt auch, wie sich journalistische Rollen verschieben. Ruhs tritt nicht nur als Moderatorin auf, sondern als politische Figur, die ihre Agenda aktiv promotet. Das ist ungewöhnlich für den ÖRR, dessen Stärke eigentlich in der Trennung von Person und Programm liegt. Die Kritik am „linksgrünen“ System wirkt dabei fast ironisch: Denn die Mission, die Ruhs sehr explizit verkörpert, ist deutlich sichtbarer als jede behauptete Schlagseite im Redaktionsalltag.
Der Gegenpol: privatfinanzierte Meinung
Medien wie NIUS oder andere rechtskonservative Plattformen bieten das, was sie dem ÖRR vorwerfen: eine politische Agenda. Sie sind nicht an Ausgewogenheit gebunden, sondern zielen direkt auf Reichweite und Resonanz. Sie inszenieren sich als Gegengewicht, sind aber oft Teil der medialen Polarisierung, nicht ihrer Lösung.
Fazit
Die Debatte um politische Ausrichtung im Journalismus, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist wichtig — aber sie braucht mehr Differenzierung, weniger Zuschreibung. Journalismus ist kein Parteiprogramm, sondern ein Beruf mit professionellen Standards. Wer ihn pauschal politisiert und auf „die Systemmedien“ durchprojiziert, betreibt nicht Kritik, sondern Delegitimierung. Und wer mediale Vielfalt will, muss sie nicht durch Zuschreibung erzwingen, sondern durch strukturelle Offenheit ermöglichen. Journalistische Qualitätsstandards sind Grundvoraussetzung dabei.

Schreibe einen Kommentar