Manchmal genügt ein Halbsatz, um eine leise Alarmglocke schrillen zu lassen. So geschehen im FAZ-Meinungsnewsletter von heute (26.09.2025), der nichts eigentlich Falsches enthält, aber im letzten Satz, wo von „Bewährungsproben“ im Zusammenhang mit Bundesverfassungsrichtern die Rede ist … Die Formulierung wirkt harmlos, fast beiläufig — und offenbart doch eine subtile Schräglage im Verständnis rechtsstaatlicher Institutionen.
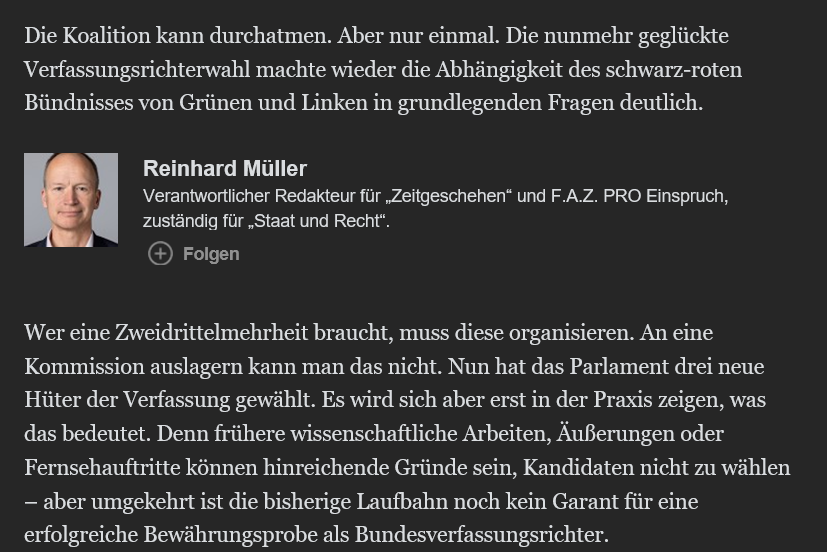
Das Bundesverfassungsgericht ist keine politische Bühne, sondern eine rechtsstaatliche Instanz. Seine Richter sind nicht zur moralischen oder parteipolitischen Bewertung freigegeben, sondern zur verfassungsrechtlichen Prüfung berufen. Schlimm genug, wenn Politiker sich angewöhnt haben, im Vorhinein nach politischer Präferenz und persönlichem Gusto über Verfassungsgerichtskandidaten zu urteilen. Untragbar aber, wenn sich das auch noch der Journalismus als eine Art legitimer Nachschau zu eigen macht.
Die implizierte Vorstellung, es habe in der Vergangenheit „versemmelte“ Bewährungsproben gegeben, ist nicht nur unbelegt, sondern anmaßend. Sie suggeriert, als sei die Legitimität der Richter abhängig von öffentlicher Zustimmung oder politischer Erwartung — ein gefährlicher Irrtum.
Bewährungsproben sind für politische Ämter denkbar – nicht aber für das Bundesverfassungsgericht. Wer seine Richterinnen und Richter zu Objekten öffentlicher „Bewährung“ macht, verkennt die Würde des Gerichts und gefährdet seine Unabhängigkeit. Das Bundesverfassungsgericht lebt nicht vom Beifall, sondern von seiner Bindung an das Grundgesetz. Wer es in die Logik der Popularität zwingt, schwächt am Ende die Verfassung selbst.

Schreibe einen Kommentar