… oder: Einfaches, Falsches und Hypes
Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog „Die Erde ist keine Scheibe“
und wird hier in leicht überarbeiteter Form wiederveröffentlicht.
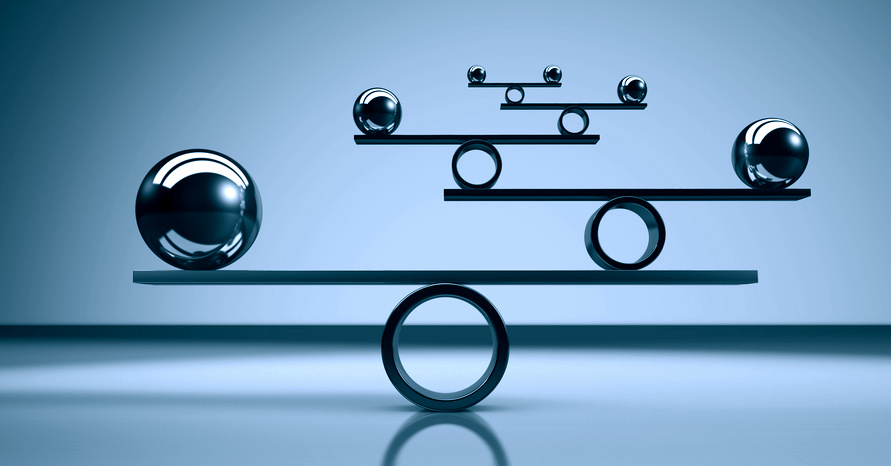
Ganz einfach – oder… ?
Komplex ist eben nicht einfach
In ihrer Untersuchung zu Mitläufereffekten („Bandwagons“ [1]) in der Medizin haben Cohen und Rothschild [2] festgestellt, dass nicht nur Patienten, sondern ebenso Ärzte oft eine neue Idee einfach deshalb akzeptieren, weil sie eben eine neue Idee ist, die Verlockung einer einfachen Lösung für ein komplexes Problem.… Weiterlesen ...



