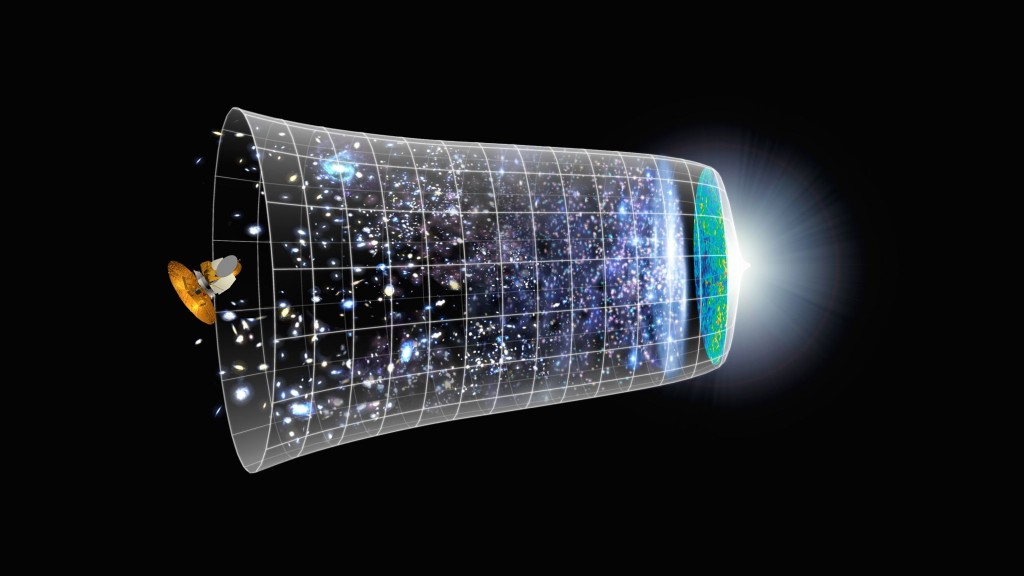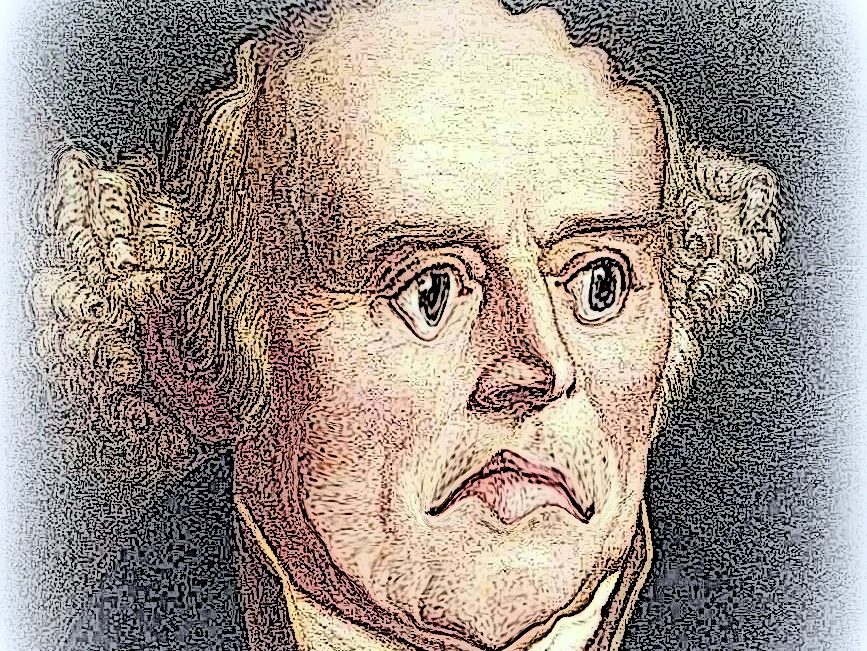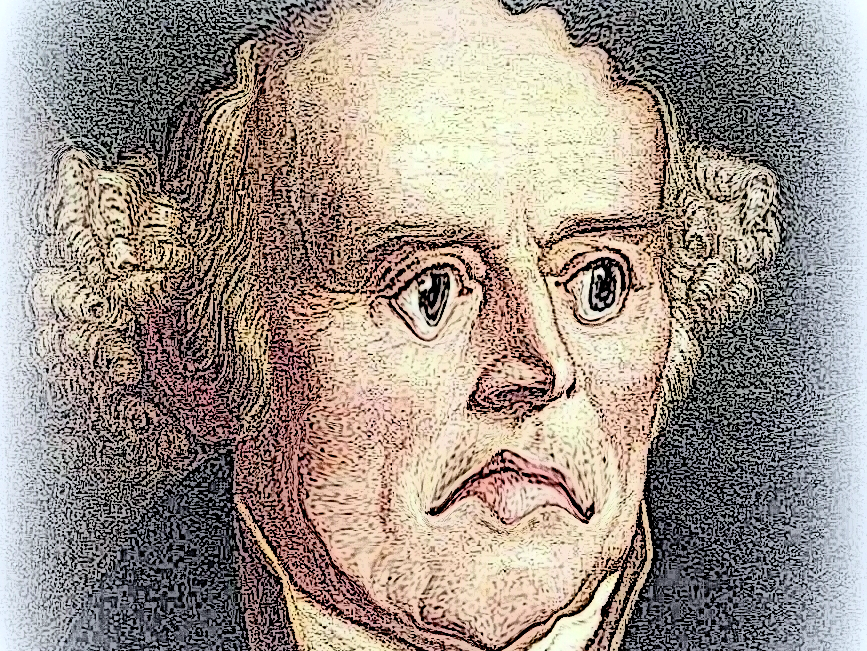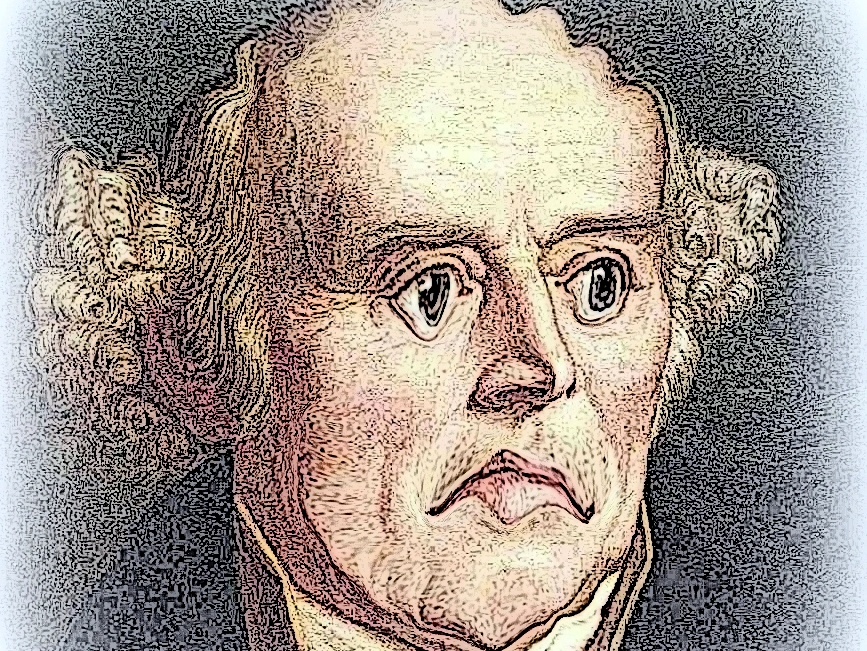Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog „Die Erde ist keine Scheibe“ und wird hier in leicht überarbeiteter Form wiederveröffentlicht.
Sicher sind den Lesern dieses Blogs noch die Beiträge aus dem vorigen Jahr in Erinnerung, die in der Folge des „Münsteraner Memorandums Heilpraktiker“ [1] die Reaktionen der Heilpraktikerszene aufgriffen, die im Wesentlichen aus zwei Faktoren bestanden: Zum einen aus „whataboutism“, also dem ebenso sachfremden wie befremdlichen Hinweis des „die da aber auch…“ und aus offener Diskreditierung der anderen Seite.… Weiterlesen ...