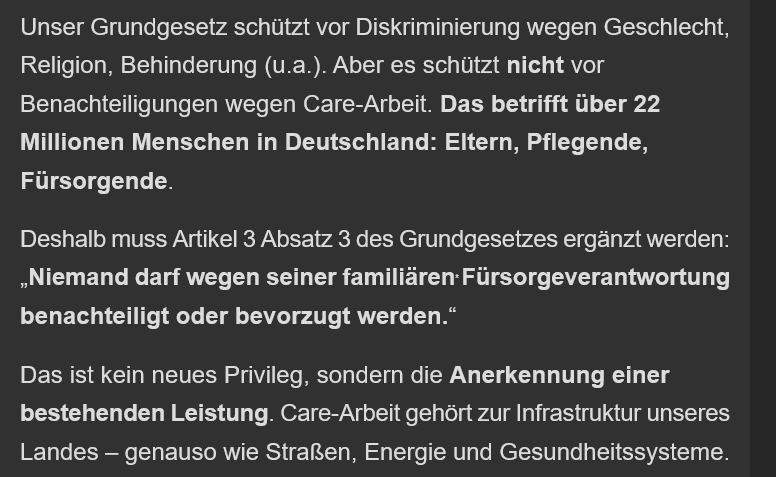
Immer wieder begegnen einem wohlmeinende Initiativen, die gesellschaftliche Missstände durch eine Änderung des Grundgesetzes beheben wollen. Jüngst etwa die Forderung, Artikel 3 Absatz 3 um den Schutz vor Benachteiligung wegen familiärer Fürsorgeverantwortung zu ergänzen. Das Anliegen ist berechtigt – die Unsichtbarkeit und strukturelle Geringschätzung von Care-Arbeit ist ein reales Problem. Aber der gewählte Weg ist systemfremd.
Für einen in Verfassungskategorien denkenden Menschen wie mich ist das eine haarsträubende Absurdität. Und doch erkenne ich die „verfassungsrechtliche Unschuld“ der Petenten: Sie wollen Gerechtigkeit, Sichtbarkeit, Anerkennung – und greifen zum höchsten Symbol, das unser Gemeinwesen kennt. Aber sie verkennen dabei die Funktion und Struktur des Grundgesetzes.
Artikel 3 – Gleichheit vor dem Gesetz, nicht Gleichheit der Lebenslagen
Artikel 3 schützt vor Diskriminierung aufgrund persönlicher Merkmale, die entweder unveränderlich sind oder zur Identitätsbildung gehören: Geschlecht, Herkunft, Religion, Behinderung. Er ist kein Auffangbecken für jede gesellschaftlich relevante Benachteiligung, sondern ein Instrument zur Sicherung staatlicher Neutralität gegenüber bestimmten Gruppenmerkmalen.
Familiäre Fürsorgeverantwortung ist kein solches Merkmal – sie ist eine soziale Rolle, oft freiwillig übernommen, oft strukturell belastet, aber nicht verfassungsrechtlich „diskriminierungsfähig“ im engeren Sinne. Wer Care-Arbeit ins Grundgesetz schreiben will, verkennt dessen Funktion: Es ist kein Reparaturbetrieb für politische Versäumnisse, sondern ein Rahmen für staatliches Handeln.
Historischer Kontext – Warum Artikel 3 so formuliert ist, wie er ist
Artikel 3 entstand unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten sicherstellen, dass der Staat nie wieder Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder anderer Merkmale systematisch benachteiligt. Die Auswahl der Merkmale in Absatz 3 erfolgte bewusst: Sie sollten Eigenschaften abdecken, die entweder unveränderlich sind oder identitätsprägend – und die in der Vergangenheit Anlass für staatliche Ungleichbehandlung waren.
Die Aufnahme weiterer Merkmale wurde stets zurückhaltend diskutiert – etwa bei der Ergänzung um „Behinderung“ im Jahr 1994. Auch diese Erweiterung blieb im Rahmen der ursprünglichen Systematik: Schutz vor Diskriminierung durch den Staat, nicht Kompensation gesellschaftlicher Rollenverteilungen.
Verfassungsrecht ist kein Wunschzettel
Die vorgeschlagene Ergänzung würde eine soziale Rolle zum Diskriminierungsmerkmal erheben – und damit einen systematischen Bruch erzeugen. Man würde dem Grundgesetz eine Funktion zuschreiben, die es nicht hat: die Herstellung individueller Gerechtigkeit durch verfassungsrechtliche Anspruchsinflation.
Das hätte weitreichende Folgen:
- Verfassungsrechtliche Überlastung: Gerichte müssten klären, was unter „Benachteiligung wegen Fürsorgeverantwortung“ fällt – von Kita-Plätzen bis zu Steuerrecht.
- Systembruch im Gleichheitssatz: Artikel 3 würde vom Schutz vor gruppenbezogener Diskriminierung zum Reparaturinstrument für soziale Ungleichheiten.
- Anspruchsinflation: Wenn familiäre Fürsorge verfassungsrechtlich geschützt wird, warum nicht auch Ehrenamt, Alleinerziehendenstatus oder Berufsgruppen?
- Politische Verantwortungsverschiebung: Die Verantwortung für Anerkennung und Absicherung würde vom Gesetzgeber auf das Verfassungsgericht verlagert.
Die Lösung liegt woanders
Die Unsichtbarkeit der Care-Arbeit ist ein reales Problem – und ich habe sie in meinen Artikeln mehrfach thematisiert. Aber die Lösung liegt nicht in einer systemwidrigen Verfassungsformel. Sie liegt in politischer Gestaltung: in der Anerkennung von Care-Arbeit als Infrastrukturleistung, in der institutionellen Absicherung, in der öffentlichen Sichtbarkeit. Dafür braucht es keine neue Diskriminierungskategorie, sondern politischen Willen.
Die gute Absicht bleibt. Aber der Ort ist falsch gewählt.
Demokratie braucht Aushandlung – nicht Abkürzungen über die Verfassung
Die berechtigte Forderung nach Sichtbarkeit und Kompensation von Care-Arbeit findet durchaus Anknüpfungspunkte im Grundgesetz – etwa in der Sozialstaatsgarantie des Artikels 20 Absatz 1. Sie verpflichtet den Staat, soziale Gerechtigkeit und Teilhabe zu fördern. Aber diese Garantie ist kein unmittelbarer Anspruch, sondern ein politischer Gestaltungsauftrag. Sie verlangt Aushandlung, Priorisierung, demokratische Willensbildung – nicht die schnelle Verfassungsformel.
Wer Care-Arbeit stärken will, muss den Weg der politischen Gestaltung gehen: durch Gesetzgebung, Infrastrukturpolitik, Anerkennungssysteme. Das ist mühsam, aber notwendig. Denn die Demokratie lebt nicht von symbolischen Verfassungsänderungen, sondern von diskursiver Verantwortung: vom Ringen um gerechte Lösungen, vom Respekt vor der Systematik des Rechts, und vom Vertrauen in die Kraft öffentlicher Argumente.
Die Unsichtbarkeit von Care-Arbeit ist ein Problem. Aber die Verfassung ist nicht der Ort, an dem man es sichtbar macht. Sie ist der Rahmen – nicht das Werkzeug.
Nachsatz: Gut gemeint – aber auch verfassungsrechtlich riskant
Wer in Artikel 3 Absatz 3 nicht nur die Benachteiligung, sondern auch die Bevorzugung – wie wohl unbedacht im Petitionsvorschlag formuliert – wegen familiärer Fürsorgeverantwortung verbieten will, stellt sich selbst eine Falle. Denn „Bevorzugung“ ist im verfassungsrechtlichen Kontext kein moralischer Vorwurf, sondern ein juristisch relevanter Begriff: Er bezeichnet jede gezielte Besserstellung gegenüber anderen – auch wenn sie politisch gewollt und sachlich gerechtfertigt ist.
Ein solches Verbot auf verfassungsrechtlicher Ebene würde bedeuten, dass der Staat keine besonderen Fördermaßnahmen mehr ergreifen dürfte, um die strukturellen Nachteile von Care-Arbeit auszugleichen. Steuerliche Entlastungen, Pflegezeitregelungen, Rentenansprüche oder arbeitsrechtliche Schutzvorschriften könnten unter Rechtfertigungsdruck geraten – obwohl sie gerade Ausdruck gesellschaftlicher Anerkennung sind.
Wer die Verfassung zum Ort der Gerechtigkeit machen will, sollte wissen, dass sie nicht nur schützt – sondern auch begrenzt. Und dass gut gemeint nicht immer gut gemacht ist.

Schreibe einen Kommentar