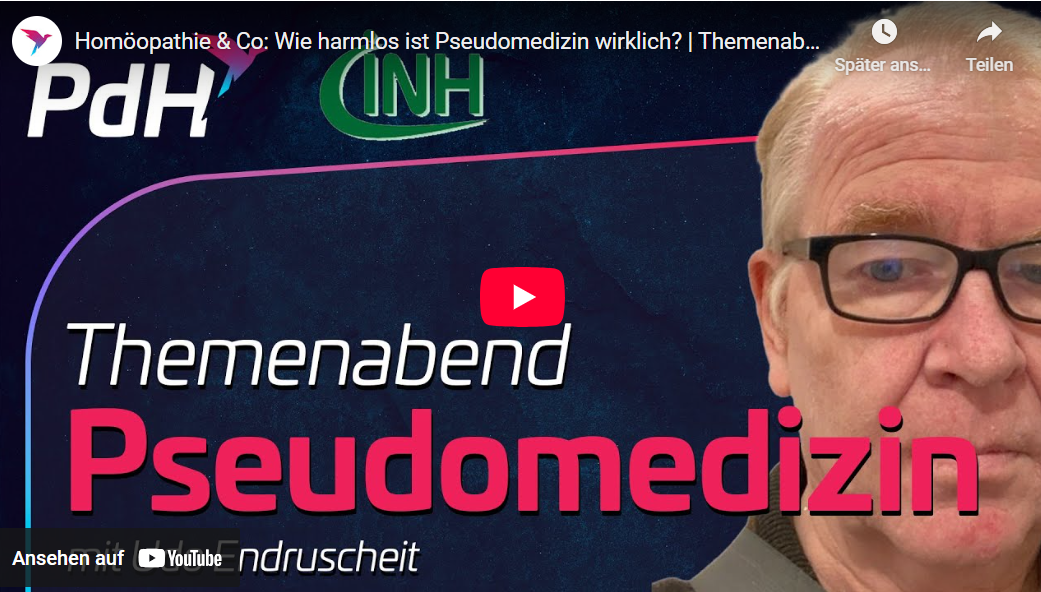Eine Nachbetrachtung zum Vortrag beim Themenabend Pseudomedizin „Hilft’s nicht, so schadet’s nicht“ der Partei der Humanisten, 20. März 2025
Am 20. März 2025 durfte ich im Rahmen eines Themenabends der Partei der Humanisten (PdH) einen Vortrag über das Schadenspotenzial der Pseudomedizin halten. Die Veranstaltung, deren Mitschnitt inzwischen online abrufbar ist, hatte ein erklärtes Ziel: differenziert, aber deutlich zu klären, warum die allzu oft verharmlosten „alternativen“ Heilverfahren nicht bloß medizinisch fragwürdig, sondern ethisch und auch gesellschaftlich hochproblematisch sind. Und doch blieb – bei aller gebotenen Informationsdichte – eines noch im Raum stehen: die tiefere Bedeutung des Begriffs „Schaden“.
Denn was meinen wir eigentlich, wenn wir von der Gefährlichkeit pseudomedizinischer Verfahren sprechen?
Die unsichtbare Gefahr
Die gängige Unterscheidung zwischen gefährlicher und harmloser Pseudomedizin wirkt auf den ersten Blick vernünftig: Was nicht unmittelbar schadet, könne man doch „laufen lassen“. Doch genau diese Haltung ist Teil des Problems. Denn sie verkennt, dass Schaden auch dort entsteht, wo er nicht physisch messbar ist – etwa durch epistemische Irreführung, kulturelle Normalisierung irrationaler Denkweisen oder strukturelle Fehlallokation von Ressourcen im Gesundheitswesen.
Pseudomedizin ist selten evidente Todesursache – aber oft die Ursache einer falschen Entscheidung. Und damit die Mitursache von Leid, das hätte vermieden werden können.
Vor allem aber ist Pseudomedizin keine isolierte Erscheinung, sondern Teil eines kulturellen Musters: Sie gedeiht dort, wo der Unterschied zwischen Wissen und Meinung, zwischen plausibler Evidenz und persönlichem Gefühl erodiert. Wenn Menschen lernen, auf „eigene Überzeugung“ mehr zu vertrauen als auf gesicherte Erkenntnis, dann ist der Weg zur Wissenschaftsfeindlichkeit, zur Impfskepsis oder zur „gefühlten Wahrheit“ längst beschritten.
Der eigentliche Schaden
Gerade Homöopathie – das Paradebeispiel einer systematisch irrelevanten Methode – hat über Jahrzehnte hinweg ihre Ungefährlichkeit wie einen Persilschein vor sich hergetragen, ja, sich sogar mit ihrer angeblichen besonderen Bedeutung für den Patientenschutz gebrüstet. Und doch untergräbt sie – wie viele andere „sanfte“ Verfahren – genau das Fundament, auf dem verantwortbare Gesundheitsentscheidungen ruhen: das Vertrauen in die Prüfbarkeit von Wissen.
Die Behauptung „Es hilft doch!“ ersetzt die Frage: „Woher wissen wir das?“. Und genau in dieser Verschiebung liegt der eigentliche Schaden. Es geht um mehr als Medizin – es geht um das gesellschaftliche Wahrheitsklima. Um die Bereitschaft, sich kritischen Maßstäben zu stellen. Um die Fähigkeit, zwischen Kausalität und Korrelation, zwischen Empirie und Wunschdenken zu unterscheiden.
Die Gefahr der Pseudomedizin liegt nicht nur im Körper, sondern im Kopf. Nicht nur im Einzelfall, sondern im Diskurs. Und deshalb ist ihre Kritik nicht nur Angelegenheit von medizinischen Detailfragen – sondern eine Frage der soziokulturellen Hygiene.
Aufklärung als Haltung
Wer Wissenschaft gegen Populismus und Beliebigkeit verteidigen will, muss sich auch erkenntnistheoretisch wappnen. Es genügt nicht, auf die Objektivität von „Zahlen, Daten, Fakten“ zu pochen, wenn wir nicht zugleich zeigen können, warum sie gelten dürfen und wie sie zustande kommen.
Der Skeptizismus, den wir brauchen, ist kein kalter Positivismus. Er ist ein ethischer Realismus – offen für Situiertheit, aber verpflichtet auf Wahrheit. Ohne diesen Anspruch verlöre Wissenschaft ihre gesellschaftliche Relevanz. Und Aufklärung ihren Sinn.