Über die politische Entkernung des Sozialstaats und die Verfassungswirklichkeit, die man kennen sollte
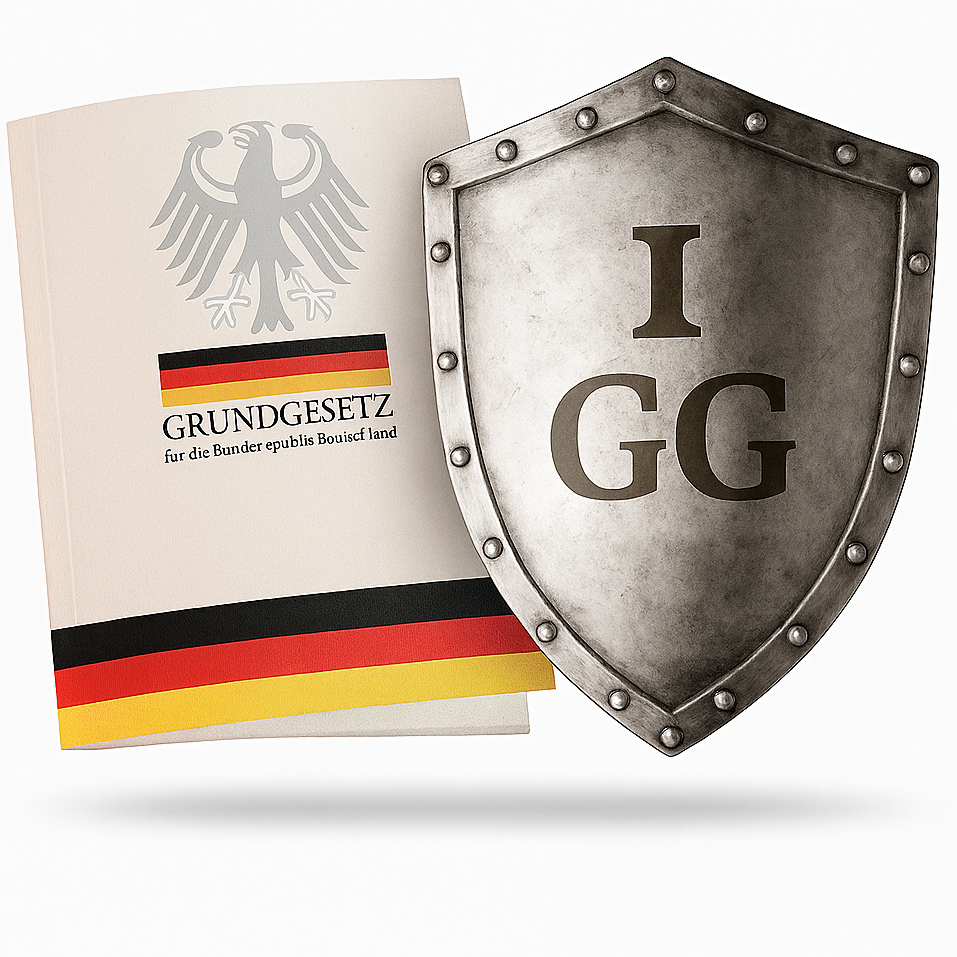
Wenn Friedrich Merz öffentlich erklärt, die Kommunen müssten „an der Ausgabenseite Korrekturen vornehmen“ – vordringlich bei der Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege – dann fragt man sich: In welchem Land glaubt dieser Mann zu leben?
Mein Sohn ist schwerstbehindert. Jung, ohne Einkommen, ohne Rente, ohne Vermögen. Dass er in einer stationären Einrichtung gepflegt werden kann, verdankt er der Hilfe zur Pflege – einer Leistung nach dem Sozialgesetzbuch, die von der Kommune getragen wird, weil die Pflegeversicherung allein nicht ausreicht. Zur freien Verfügung bleiben ihm 180 Euro im Monat. Davon müsste er seinen ganzen persönlichen Bedarf bestreiten, von Kleidung über Toiletteartikel bis zur Tafel Schokolade und einer gelegentlichen Zigarette und sogar seine persönlichen Versicherungen wie Haftpflicht und Sterbevorsorge. Herr Merz, wo genau soll hier gespart werden?
Diese Leistungen der Kommune nach dem SGB sind keine freiwilligen Wohltaten. Sie beruhen auf Bundesgesetzen – dem Sozialgesetzbuch, das nicht zur Disposition steht. Die Kommunen sind zur Durchführung verpflichtet, nicht zur freien Gestaltung berechtigt. Wer hier „Korrekturen an der Ausgabenseite“ fordert, kennt offenbar die föderale Struktur der Aufgabenübertragung nicht, ignoriert die verfassungsrechtlich verankerte Pflicht zur Gesetzesausführung – und die Realität jahrzehntelanger Unterfinanzierung der kommunalen Ebene. Herr Merz, wo genau soll hier gespart werden?
Ich kann nicht zählen, in wie vielen „Einsparungsrunden“ ich in den letzten 20 Jahren meiner Dienstzeit gesessen habe. Die Sparideen gingen teils ins Absurde, bis hin zum Büromaterial (das viele Kollegen schon von zu Hause mitbrachten). Nicht wegen verschwenderischen Haushaltens, sondern weil die Kommunen seit Jahrzehnten strukturell unterfinanziert sind, gemessen an ihrem Aufgabenbestand. Das bestätigen unisono die kommunalen Praktiker, die kommunalen Verbände und auch die Wissenschaft. Wenn Regierungspräsidenten auf die Kommunen Spardruck ausgeübt haben – und das haben sie –, dann ging es nicht um gesetzlich fixierte Pflichtleistungen. Es ging um das, was die kommunale Selbstverwaltung eigentlich ausmacht: die soziokulturelle Gestaltung des Gemeinwesens. Dass unser Stadtbild nicht längst dem von Schwellenländern ähnelt, verdanken wir nicht dem Bund, sondern der Kreativität und Verantwortung der Kommunen. Und das, obwohl der Bund sich seit Jahrzehnten weigert, ihnen einen angemessenen Anteil am Einkommensteueraufkommen zuzuweisen. Herr Merz, wo genau soll hier gespart werden?
Dass verfassungsrechtlich fixierte staatliche Pflichtleistungen nicht unter Haushaltsvorbehalt gestellt werden dürfen, hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach klargestellt – zuletzt im Urteil vom 5. Mai 2020 zur Beamtenbesoldung. Dort heißt es: Die amtsangemessene Alimentation ist eine verfassungsrechtlich garantierte Leistung, die sich aus Art. 33 Abs. 5 GG ergibt und nicht aus fiskalischen Gründen abgesenkt werden darf. Der Staat kann sich nicht auf Sparzwänge berufen, um seine verfassungsrechtlichen Pflichten zu unterlaufen.
Und das gilt nicht nur für die Beamtenbesoldung. Es gilt für alle staatlichen Leistungen, die aus der Verfassungsordnung folgen – insbesondere für die Basics der sozialstaatlichen Leistungen wie z.B. die Hilfe zur Pflege, die Eingliederungshilfe, die Jugendhilfe. Wer hier „Korrekturen“ fordert, stellt nicht nur die Lebensrealität der Betroffenen infrage, sondern auch die Verfassungsbindung des politischen Handelns.
Dabei lohnt ein Blick auf das Grundgesetz selbst: Es schreibt keine bestimmte Wirtschaftsform vor. Das Bundesverfassungsgericht hat dies mehrfach bestätigt. Zulässig sind auch Modelle, die aus konservativer Sicht als „sozialistisch“ gelten könnten – solange sie die Grundrechte, die demokratische Ordnung und die Menschenwürde achten. Das Sozialstaatsprinzip dagegen gehört zu den verfassungsimmanenten Grundlagen. Es ist nicht disponibel. Es ist nicht haushaltsabhängig. Es ist nicht ideologisch relativierbar.
Man muss es so deutlich sagen: Das Grundgesetz schützt nicht das Marktmodell, sondern den Menschen. Wer das vergisst, mag sich konservativ nennen – handelt aber verfassungswidrig.

Andreas Lichte
„wo kein Kläger, da kein Richter“
Diese, „unsere“ Regierung verstößt meines Erachtens routinemässig gegen geltendes Recht, zur Illustration ein Artikel von Udo Endruscheit: https://hpd.de/artikel/den-rechtsstaat-nicht-mehr-aushaelt-23116
Das macht die Regierung so lange, bis geklagt wird. Wenn es überhaupt zum Prozess kommt, dann dauert es bis zum Urteil in der Regel ewig.
Falls das Gesetz aufgehoben werden muss, gibt es in der nächsten Legislaturperiode dann eben ein neues Gesetz mit dem leicht abgewandelten Rechtsbruch.
Die einzige Frage, die sich mir stellt: wer wählt den permanenten Rechtsbruch?
(ich bitte diesen langweiligen, langweiligen Kommentar zu entschuldigen – aber es ist „unsere“ Regierung, die sich wiederholt)
Udoessen999
Der Kommentar wirft durchaus eine für mich auch immer wieder auftauchende Kernfrage auf; Wer wählt – immer wieder – den Rechtsbruch und eine Politik zum eigenen Schaden?
Fragt mich nicht.
Andreas Lichte
… und heute, 26.11.2025, die neueste Variante des Themas:
„Zuchtmeister Staat: Zur semantischen Entgleisung im Sozialrecht“, https://hpd.de/artikel/zuchtmeister-staat-zur-semantischen-entgleisung-im-sozialrecht-23588
Mir gefällt der Artikel sehr gut, die juristische Argumentation finde ich plausibel, allerdings fehlt mir ein Jura-Studium oder ähnliches, um wirklich mitreden zu können.
–
Ganz allgemein stelle ich fest, dass Arbeit immer mehr von etwas „Sinnstiftendem“ zur „Sklaverei“ gemacht wird.
Meine Diplomarbeit hatte das Thema „Spiel“ – da geht es vor allem um Freiwilligkeit. Auch der ein oder andere Klassiker findet das nicht ganz unwichtig:
„Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt …“