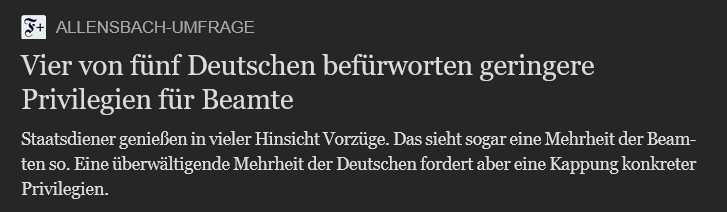
Manchmal, wenn die Schlagzeilen wieder rauschen und die Balkendiagramme ihre Meinung verkünden, frage ich mich, ob wir nicht längst verlernt haben, zu unterscheiden. Zwischen Stimmung und Urteil. Zwischen Ahnung und Einsicht. Zwischen dem, was man fühlt — und dem, was man wissen müsste, um zu urteilen.
Vier von fünf Deutschen, heißt es, wollen weniger Privilegien für Beamte. Eine Zahl, die klingt wie ein Urteil. Aber ist sie nicht eher ein Echo? Ein Echo auf Schlagworte, die sich festgesetzt haben: „Privilegien“, „Staatsdiener“, „Alimentation“. Worte, die mehr transportieren als erklären. Worte, die nicht fragen, sondern behaupten.
Ich will nicht dastehen, als verteidige ich meine eigenen Privilegien. Welche denn? Ich bin durchaus nicht gegen Reformen — da, wo sie sinnvoll und vertretbar sind. Und ich bin sicher: So mancher würde sich wundern, wie schnell und gern ich manches aufgeben würde, was in aller Unschuld als „Privileg“ konnotiert wird. Denn was oft als Vorteil erscheint, ist in Wahrheit Teil eines Systems, das seinen Preis hat. Einen Preis, den ein Beamtenleben zahlt — Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und den niemand im Fokus hat.
Ebenso wenig wie den Sinn, den diese sogenannten Privilegien im Kontext des grundgesetzlich verankerten Berufsbeamtentums haben. Sie sind keine Belohnung, sondern Bindung. Kein Bonus, sondern Bürde. Und wer darüber urteilt, sollte wissen, worüber er spricht.
Umfragen sind ein Instrument. Sie können Stimmungen erfassen, ja. Aber sie sind kein Ersatz für Verständnis. Und wenn sie gezielt Vorurteile abfragen, dann sind sie keine Diagnose, sondern Teil des Problems.
Vielleicht darf man sich eine kleine Klage erlauben. Nicht laut, nicht bitter. Nur leise. Eine Klage darüber, dass die Komplexität der Dinge immer öfter dem schnellen Urteil geopfert wird. Und dass man, wenn man lange genug zugesehen hat, irgendwann nur noch den Kopf neigt — nicht aus Zustimmung, sondern aus Müdigkeit.

Schreibe einen Kommentar