Die Vermögensteuer – juristisches Relikt oder politisches Tabu?
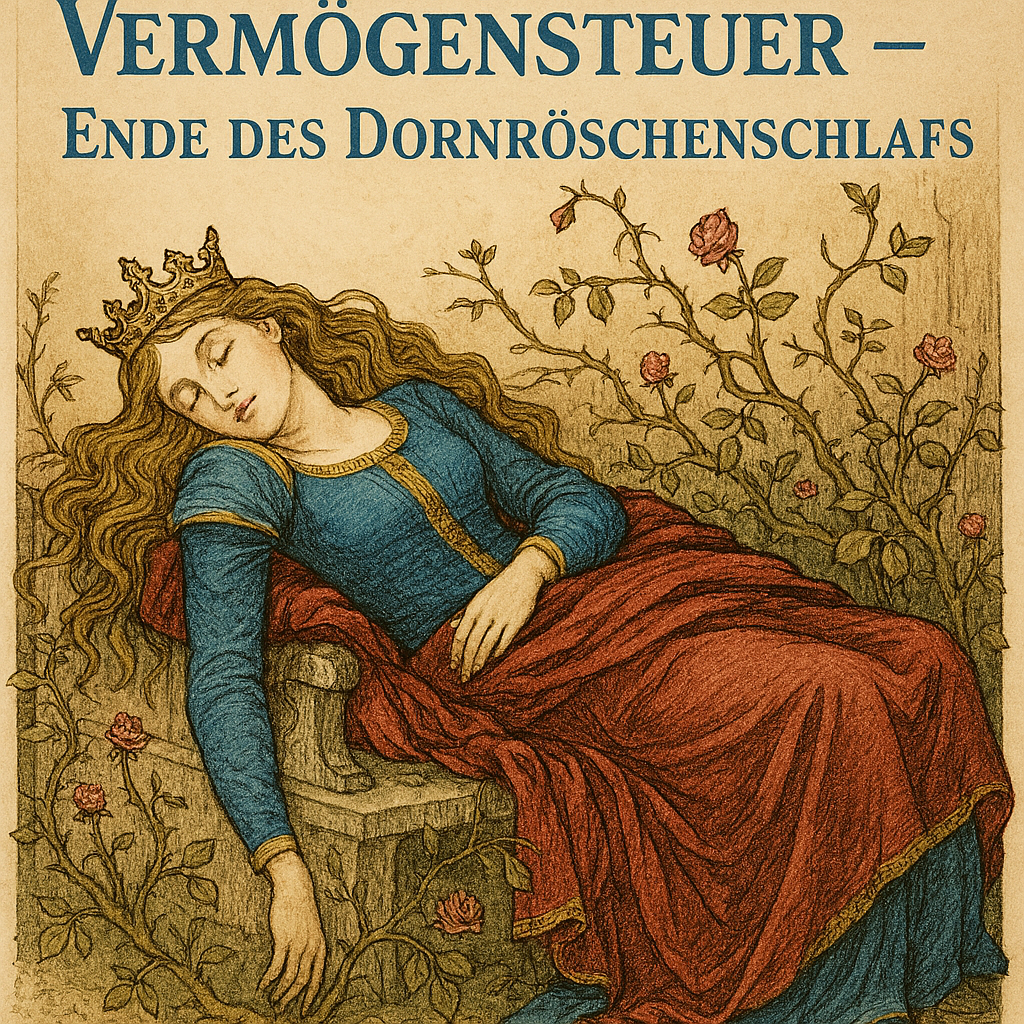
Seit 1997 wird in Deutschland keine Vermögensteuer mehr erhoben. Juristisch ist sie jedoch nicht abgeschafft – ihre Grundlage findet sich weiterhin in Art. 106 Abs. 1 Nr. 5 GG und im Vermögensteuergesetz. Ihr „Dornröschenschlaf“ begann mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Juni 1995: Die damaligen Einheitswerte für Grundvermögen waren veraltet und führten zu Ungleichbehandlungen gegenüber anderen Vermögensarten. Das Gericht erklärte diese Bewertungsgrundlage für verfassungswidrig – nicht aber die Vermögensteuer als solche.
Der Gesetzgeber hätte eine Neuregelung schaffen müssen, ließ die Frist aber verstreichen. So verschwand die Steuer aus der Praxis, ohne formell aufgehoben zu werden.
Neue Lage seit der Grundsteuerreform
Ein Blick auf ein anderes Gebiet des Steuerrechts offenbart Wichtiges für den Bereich der Vermögenssteuer: Mit der Grundsteuerreform, die 2025 greift, sind die Bewertungsgrundlagen für Grund und Boden aktualisiert. Das zentrale Hindernis für die Wiedererhebung ist damit juristisch beseitigt. Es gibt heute keine verfassungsrechtlichen Gründe mehr, die einer Vermögensteuer entgegenstehen. Sie ist ein „Instrument im Wartestand“ – aktiviert werden müsste es allein durch den Gesetzgeber.
Politische Kommunikation: Mythen statt Klarheit
Statt diese Lage zu benennen und zur Diskussion zu stellen, wird das Thema politisch abgewehrt – oft mit fragwürdigen, um nicht zu sagen falschen Begründungen. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte etwa öffentlich, das Bundesverfassungsgericht habe „jede Form von Vermögenssteuer“ für unvereinbar mit dem Gleichheitsgrundsatz erklärt. Tatsächlich beanstandete das Gericht 2014 nur die ungleichen Bewertungsmaßstäbe für Grund und Boden gegenüber anderen Vermögensarten – und genau das ist über die Grundsteuerreform erledigt.
Solche Aussagen verdecken, dass die Vermögensteuer juristisch möglich wäre. Die Debatte wird mit Kampfbegriffen wie „Neidsteuer“ erstickt, anstatt nüchtern über ihre Ausgestaltung zu sprechen.
Politische Optionen
Die Vermögensteuer ist ausgesetzt, nicht abgeschafft. Ihre Wiedererhebung wäre kein radikaler Bruch, sondern die Reaktivierung eines Instruments, das in vielen Staaten selbstverständlich ist – etwa Frankreich, Spanien, Norwegen oder der Schweiz.
Die SPD zeigt sich gespalten, die Grünen fordern seit Jahren eine Rückkehr, in der Zivilgesellschaft wächst der Druck („Tax the Rich“). Mit aktualisierten Bewertungsgrundlagen sind die Voraussetzungen da – jetzt geht es nur noch um politischen Willen.
Ausblick: Steuerpolitik als Gerechtigkeitsfrage
Die Vermögensteuer ist mehr als ein fiskalisches Instrument. Sie wäre ein Signal, dass auch die stärksten Schultern in Zeiten wachsender Ungleichheit und knapper öffentlicher Mittel einen fairen Beitrag leisten. Der damit verbundene Umverteilungseffekt ist nicht problematisch, sondern zu begrüßen. Die frühen republikanischen Staatsrechtler waren sich alle darüber im klaren, dass zunehmende Vermögensungleichheit den republikanischen Gedanken gefährdet – irgendwann gibt es keine „res publica“, keine „gemeinsame Sache“ mehr, die das staatliche Gebilde zusammenhält. Der Ausgleich allzu großer Vermögensungleichheit ist daher ein Gebot staatlicher Vernunft, um nicht in eine Oligarchie abzugleiten – oder Schlimmeres.
Wer die Grundsteuer reformiert hat, hat damit auch die Basis für eine gerechte Vermögensteuer geschaffen. Wer zugleich über Haushaltslöcher und soziale Spaltung klagt, sollte sich nicht länger hinter vermeintlichen juristischen Hürden verstecken.
Es ist Zeit, den Dornröschenschlaf zu beenden. Die Vermögensteuer ist bereit – die Frage ist, ob die Politik es auch ist.

Schreibe einen Kommentar