Was auf diesem Blog als kritische Auseinandersetzung mit Pseudomedizin begann, ist längst zur politischen Stimme geworden. In Zeiten wachsender Entfremdung zwischen der politischen Ebene, insbesondere der amtierenden Regierung, und großen Teilen der Gesellschaft ist Schweigen keine Option mehr. Ein persönlicher Essay über Selbstermächtigung, Verantwortung – und die Kraft des Schreibens.
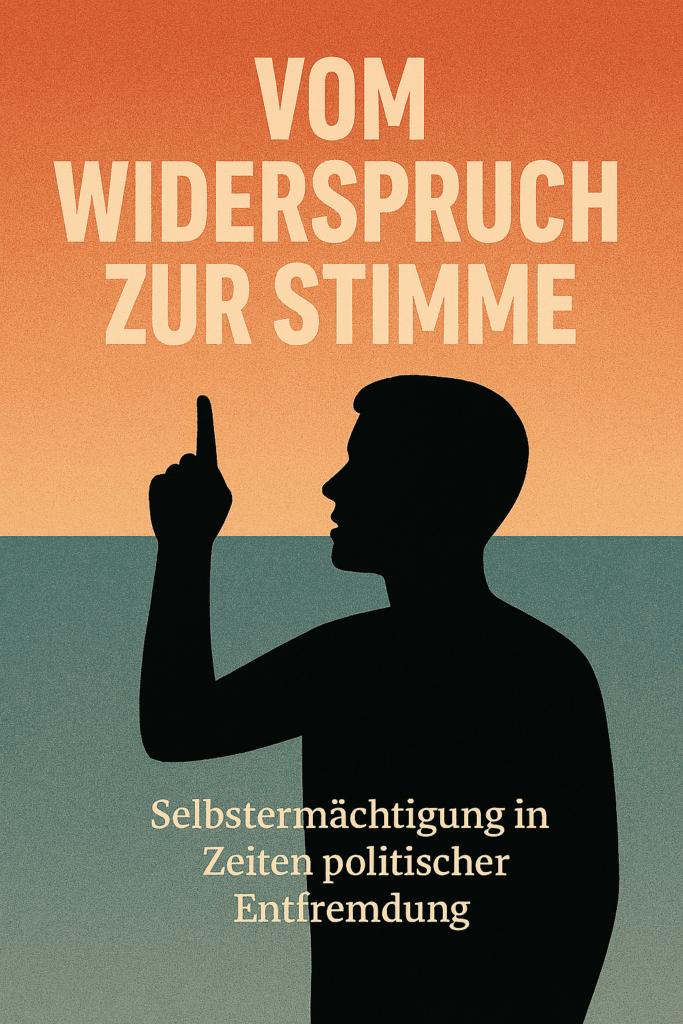
Ich habe lange beobachtet, lange gelesen, lange nachgedacht. Doch irgendwann war klar: Das reicht nicht mehr. Denn die politische Entfremdung der politischen Richtung von der Lebenswirklichkeit vieler Menschen, die sich in den letzten Monaten so deutlich zeigt, ist nicht nur ein strukturelles Phänomen – sie ist eine Zumutung. Und sie verlangt Antwort.
Meine Antwort ist: Schreiben.
Was auf diesem Blog vor neun Jahren als kritische Auseinandersetzung mit Pseudomedizin begann, war von Anfang an politisch. Denn wer sich gegen esoterische Heilsversprechen stellt, stellt sich auch gegen die Entwertung von Wissenschaft, gegen die Vernebelung von Verantwortung, gegen die systematische Verdummung im Gewand der Selbstoptimierung.
Die Kritik an Homöopathie, Anthroposophie und anderen pseudomedizinischen Praktiken war nie nur medizinisch – sie war ein Einspruch gegen die Aushöhlung rationaler Diskurse. Und damit auch gegen eine Politik, die solche Diskurse oft lieber meidet als verteidigt, sie allzu oft gar befördert.
Heute schreibe ich auch über Sozialpolitik, über Wirtschaft, über die Schuldenbremse, über die Entfremdung der politischen Klasse von der Bevölkerung. Dies geschieht aus der Lebenserfahrung und der beruflichen Expertise aus fünf Jahrzehnten – und ich habe meine politische Sozialisierung in frühen Jahren in einem klassischen Ruhrgebiets-Arbeiterhaushalt nicht vergessen. Heute wohne ich wieder im Stadtteil meiner Kindheit und Jugend.
Ich sehe, wie sich die Öffentlichkeit verändert. Wie sich Menschen zu Wort melden, die lange geschwiegen haben. Wie sich in Reels, Blogartikeln, Kommentaren und Essays eine neue Form von Gegendruck artikuliert – nicht organisiert, aber wach. Auch im nachbarschaftlichen Gespräch, im Freundeskreis und allgemein im sozialen Miteinander.
Die politische Kommunikation hat sich in den letzten Monaten spürbar verändert, und das nicht nur im Ton, sondern auch in der Form. Die Zunahme politischer Reels, Kurzvideos auf Instagram und TikTok, ist ein Symptom für eine tiefergehende Verschiebung: Die klassische politische Öffentlichkeit – geprägt von Talkshows, Leitartikeln und Parteitagen – wird zunehmend ergänzt (und manchmal überholt) von dezentralen, emotional aufgeladenen, oft treffend pointierten Mikroöffentlichkeiten. Was sich durch vielfache und anhaltende Kritik an den hergebrachten Medienformaten nach meiner Beobachtung lange vorbereitet hat (Stichwort Einladungspraxis in solche Runden, Stichwort „Sommerinterviews“).
Laut einer Studie zur Bundestagswahl 2025 wurden allein zwischen Januar und Februar über 18.000 politische Kurzvideos analysiert – ein Großteil davon Reels und TikToks. Besonders auffällig:
- 53 % der Beiträge richteten sich explizit an junge Menschen und zukünftige Generationen.
- 76 % setzten auf direkte Ansprache („du“, „ihr“) – also auf Nähe statt Distanz.
- Die Tonalität war oft konfrontativ, besonders auf TikTok, wo Angriffe auf politische Gegner deutlich häufiger vorkamen als auf Instagram.
Es ist also empirisch belegbar: Die politische Kommunikation wird emotionaler, unmittelbarer – und sie wird von unten getrieben. Nicht nur Parteien, sondern auch Einzelpersonen, Aktivist:innen und enttäuschte Bürger:innen nutzen diese Formate, um Missstände zu benennen, Kritik zu äußern und Alternativen zu skizzieren.
Und ja, es ist ein Zeichen dafür, dass viele etwas für „grundsätzlich faul“ halten. Die Reels sind nicht nur Ausdruck von Protest, sondern auch von politischer Selbstermächtigung. Sie zeigen: Die Menschen wollen nicht länger nur zuhören – sie wollen mitreden. Und sie tun es dort, wo sie gesehen werden.
Die Entfremdung bleibt nicht unbeantwortet. Sie erzeugt Stimmen. Und meine will eine davon sein. Nicht als Aktivist, nicht als Parteigänger, sondern als jemand, der sich weigert, die Dinge einfach laufen zu lassen.
Was mich antreibt, ist nicht Empörung, sondern Klarheit. Nicht Wut, sondern Verantwortung. Denn wenn die politische Kommunikation sich in Selbstgewissheit verliert, braucht es Menschen, die widersprechen. Und wenn die ökonomische Debatte sich in ideologischen Versatzstücken erschöpft, braucht es Stimmen, die erinnern: an Zusammenhänge, an Prinzipien, an Wirklichkeit. Und ich mache es so, wie ich es wohl am besten kann und getan habe: analytisch, logisch und orientiert an der bestmöglichen Evidenz, die es ja nicht nur in der Medizin gibt.
Ich schreibe, weil ich es muss. Weil ich es kann. Und weil ich es nicht mehr lassen will. Und weil mir die nächste – aus meiner Sicht bereits die übernächste – Generation nicht gleichgültig ist.
Illustration: Microsoft Copilot

Schreibe einen Kommentar