Weil es so passt zum voraufgegangenen Blogbeitrag über 150 Tage Entfremdung. Heute im FAZ-Meinungsnewsletter: Der Sozialstaat „erwürgt“ das Wachstum. So steht es da, ganz ohne Ironie, aber mit umso mehr Selbstgewissheit.

Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Die Umverteilung, die soziale Sicherung, die Stabilisierung von Nachfrage – all das wird als Bremsklotz der Ökonomie dargestellt. „Und das sind erwachsene Menschen!“, hätte meine gute alte Ruhrgebiets-Oma dazu gesagt. Und sie hätte recht gehabt. Und was sie hätte damit sagen wollen, das ist: Die Wirtschaft und der Staat sind für die Menschen da, nicht umgekehrt. Man möge nicht überlesen, dass der FAZ-Kommentator ganz offensichtlich nicht dieser Ansicht ist.
Denn was hier als Meinung verkauft wird, ist in Wahrheit die Rückkehr zur Küchenökonomie: Der Staat soll sparen wie Oma mit dem Haushaltsbuch, und wenn Opa nicht bald den Schnaps reduziert, gibts Ärger. Wer mehr ausgibt als einnimmt, ist moralisch verdächtig. Dass Volkswirtschaft anders funktioniert – mit Kreisläufen, mit Nachfrage, mit Investitionsimpulsen – scheint außerhalb des Horizonts zu liegen.
Die Schuldenbremse wird gefeiert, obwohl sie längst als ökonomischer Kurzschluss entlarvt ist. Der Staat soll sich zurückziehen, obwohl die Binnenkonjunktur lahmt. Aber eine Steuerpolitik, die erklärtermaßen das Kapital und die Bestverdienenden noch weiter entlasten soll, die ist naütrlich in Ordnung.
Das ist nicht nur ökonomisch fragwürdig, sondern politisch gefährlich. Denn es legitimiert eine Politik, die sich zunehmend von der Realität der Mehrheit entfernt.
Man kann nicht alles kommentieren. Aber manchmal ist die Ahnungslosigkeit so illustrativ, dass man einfach nicht schweigen darf. Denn wenn Meinung zur Ersatzhandlung für ökonomisches Denken wird, dann ist es höchste Zeit, dass sich die Vernunft zu Wort meldet.
Und wenn man dabei ein wenig scharf wird – nun ja: „Dat muss auch ma sein“, hätte Oma gesagt.
Doch es geht noch weiter im Meinungsnewsletter, besser wirds allerdings nicht:
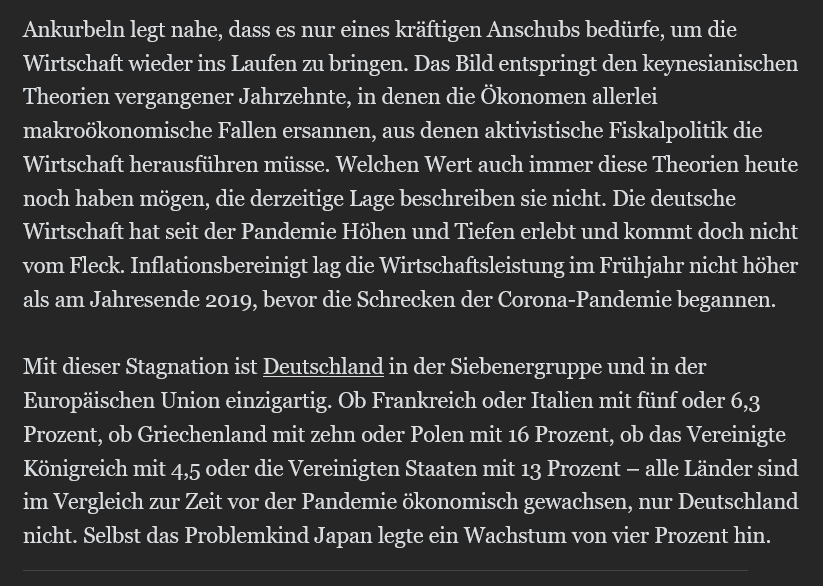
Wer den Keynesianismus als „überholt“ abtut, aber gleichzeitig rätselt, warum die deutsche Wirtschaft nicht anspringt, liefert ein Paradebeispiel für analytische Selbstverleugnung.
Keynesianismus als Sündenbock – und die Realität?
Die Vorstellung, dass staatliche Nachfrageimpulse das Wachstum „erwürgen“, ist nicht nur historisch falsch, sondern aktuell widerlegt. Gerade der so bemühte wie verfehlte Vergleich mit anderen westlichen Ländern zeigt: Dort, wo der Staat in der Krise investiert hat – in Infrastruktur, soziale Sicherung, Zukunftstechnologien – hat sich die Wirtschaft deutlich schneller erholt. Staatliche Interventionen als Wirtschaftshemmnisse für Deutschland zu kritisieren und gleichzeitig die Länder, die genau mit solchen Interventionen erfolgreich waren, als Beispiele anzuführen, dazu gehört schon was.
Und Deutschland? Hat sich mit der Schuldenbremse aus der Verantwortung gestohlen. Die Schuldenbremse war der Automatismus, der jede konjunkturelle Gegenbewegung unterband – und das in einer Phase, in der private Nachfrage und Investitionen ohnehin schwächelten.
Was wir hatten, war nicht zu viel Staat – sondern zu wenig. Und nun soll ein „liberalistischer Kurs“ mit noch weniger staatlicher Beteiligung die Lösung sein? Das ist keine Strategie, das ist nicht mal Realitätsverweigerung, das ist einfach nicht nachvollziehbar.
Japan: Hohe Schulden, aber Wachstum
Und dann Japan. Das angebliche „Problemkind“ legt 2025 ein nominales Wachstum von 2,7 Prozent vor – mit einem Schuldenstand von über 230 Prozent des BIP. Und trotzdem funktioniert der Kreislauf, weil der Staat investiert, stabilisiert und Nachfrage erzeugt. Japan hier auch noch auf den Schild zu heben als Beispiel für Deutschland, das ist absurd. Auch Japan ist erfolgreich, weil es die deutschen Fehler vermieden hat. So einfach ist das.
Japan zeigt: Hohe Staatsverschuldung ist kein Selbstzweck, aber auch kein Hindernis, wenn sie klug eingesetzt wird. Die Vorstellung, dass Schulden per se schlecht sind, ist ein Relikt aus der Haushaltsbuchlogik – nicht aus der Volkswirtschaftslehre.
Fazit: Meinung ersetzt Analyse
Was der FAZ-Kolumnist hier betreibt, ist keine ökonomische Analyse, sondern eine ideologische Erzählung. Eine, die sich gegen die Realität immunisiert und lieber alte Feindbilder pflegt als neue Zusammenhänge zu verstehen. Und die nicht vor Widersprüchen in der eigenen Argumentation zurückschreckt. Und: Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
Und ja – man fasst sich an den Kopf. Denn das ist nicht nur inhaltlich dürftig, sondern politisch gefährlich. Wer in einer Phase struktureller Schwäche den Staat weiter zurückdrängen will, betreibt keine Reform – sondern Rückbau.

1 Pingback