
Illustration von Microsoft Copilot
Als Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gestern (22.08.2025) im Spiegel-Interview vorschlug, Rentner zu einem Pflichtjahr für die Gesellschaft zu bewegen, war die Reaktion blitzartig – und vorhersehbar. Empörung, Spott, Zustimmung: Die Debatte entfaltete sich entlang der üblichen Linien. Was dabei kaum jemand fragte: Warum wird die Verteilungsfrage eigentlich auch hierbei wieder nicht gestellt? Immerhin wurde sie von Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, klar angesprochen. Wofür man dankbar sein muss.
Stattdessen wurde ein Generationenkonflikt inszeniert, der von der wahren Konfliktlinie ablenkt: der ökonomischen Ungleichheit. Das Spielfeld von Fratzschers Vorschlägen beschränkt sich auf die unteren Einkommensgruppen – jene, die durchweg weder exorbitante Einnahmen noch hohe Vermögenswerte besitzen. Nur die will er untereinander neu „solidarisieren“. Die Frage, wie Einkommen und Vermögen in Deutschland insgesamt verteilt sind, bleibt völlig außen vor. Dabei wäre genau das der Schlüssel zu einem neuen Generationenvertrag, der diesen Namen verdient: einer, der nicht nur Pflichten verteilt, sondern auch Privilegien hinterfragt.
Wer über Generationengerechtigkeit spricht, ohne die strukturelle Ungleichheit zu thematisieren, betreibt bestenfalls ein intellektuelles Spiel. Und schlimmstenfalls eine Entsolidarisierung unter dem Deckmantel der Zukunftsverantwortung.
Boomer-Bashing als politisches Ablenkungsmanöver
Fratzschers Vorstellung, die Generation der Babyboomer solle nun durch ein Pflichtjahr „büßen“, weil sie angeblich die Sozialsysteme aus dem Gleichgewicht gebracht habe, ist auf so vielen Ebenen schief, dass man nur den Kopf schütteln kann.
Wofür genau sollen sie verantwortlich sein? Für zu wenige Kinder? Für zu lange Rentenbezugszeiten? Dass sie nicht früh genug sterben? Für ein System, das sie nicht entworfen, sondern lediglich durchlebt haben?
Die Wahrheit ist: Die Boomer haben unter den Bedingungen gearbeitet, die ihnen politisch und ökonomisch vorgegeben wurden. Sie haben Steuern gezahlt, Kinder erzogen, oft jahrzehntelang gearbeitet – und dabei ein System gestützt, dessen strukturelle Schwächen längst bekannt waren.
Dass die Politik es versäumt hat, rechtzeitig auf demografische und ökonomische Entwicklungen zu reagieren, ist kein individuelles Versagen der Boomer, sondern ein kollektives Versagen der politischen Steuerung. Wer heute mit dem Finger auf die Rentner zeigt, betreibt nicht Aufarbeitung, sondern Ablenkung.
Boomer-Bashing ist bequem – es spart die Auseinandersetzung mit den eigentlichen Ursachen:
- Einer verfehlten Steuerpolitik
- Einer unterfinanzierten Pflege- und Rentenstruktur
- Und einer politischen Kultur, die lieber Symptome moralisiert als Strukturen reformiert
Ein ähnliches Muster zeigt sich bei der Debatte um Beamtenpensionen: Seit der Grundsatzentscheidung für ein Berufsbeamtentum „nach hergebrachten Grundsätzen“ in der Frühphase der Bundesrepublik wurde ihnen ein deutlich geringerer Bruttolohn zugemutet als ihren angestellten Kollegen – mit dem Versprechen einer Versorgung im Alter. Insofern haben die Beamten – anders als im kollektiven Bewusstsein unterstellt – sehr wohl „eingezahlt“ für ihre Pensionen. Doch die Politik hat es versäumt, die eingesparten Mittel in nachhaltige Rücklagen zu überführen. Was als Lohnverzicht als Gegenleistung für spätere Versorgung gedacht war, wurde schlicht in den Haushalten für ganz andere Dinge verfrühstückt. Das hat man im Laufe der Jahre in der Debatte offenbar vergessen und verdrängt. Und nun sollen die Betroffenen Schuld sein an den Pensionslasten?
Ein Blick zurück: Mellon, Morgenthau und die Verschiebung des politischen Denkens
Schon in den 1920er Jahren prägte Andrew Mellon als US-Finanzminister eine Steuerpolitik, die Reichtum als Leistung und Umverteilung als Gefahr definierte. Seine Maxime: „Steuern müssen die Produktiven nicht bestrafen.“ Diese Denkweise wurde zur Blaupause für eine Politik, die Ungleichheit nicht bekämpft, sondern legitimiert. 1933, beim Amtsantritt von Franklin D. Roosevelt, stand die Working Class in den USA kurz vor der Verelendung.
Henry Morgenthau Jr., Finanzminister unter Roosevelt, war einer der Architekten des nun folgenden New Deal. Er sah Milliarden fließen, Programme entstehen, Hoffnung keimen. Und doch war er am Ende resigniert. Zwar hatte der New Deal den völligen Absturz der arbeitenden Klasse abgefangen, aber das eigentliche Ziel wurde verfehlt: Die gesellschaftlichen Verhältnisse blieben bestehen. In Morgenthaus Tagebüchern und späteren Reflexionen wird deutlich: Er war überzeugt, dass der New Deal zwar kurzfristig wirkte, aber langfristig versagte, weil die Steuerpolitik unangetastet blieb. Die Reichen zahlten weiterhin vergleichsweise wenig, Vermögen blieb weitgehend unangetastet, und die Erbschaftsregelungen konservierten die bestehenden Machtverhältnisse.
Morgenthau verstand Politik als „Staatskunst“ – als moralisch verantwortliches Handeln im Spannungsfeld von Macht und Gerechtigkeit. Für ihn war Politik kein technokratisches Management, sondern ein Ringen um Prinzipien. Heute jedoch dominiert ein Politikverständnis, das sich auf „Sachzwänge“ beruft, auf Haushaltsdisziplin und Wettbewerbsfähigkeit – und dabei die soziale Realität ausblendet.
Die Gegenwart: Ungleichheit als blinder Fleck der Politik
Die Reaktionen auf Fratzschers Vorschlag eines Pflichtjahres für Rentner zeigen, wie tief diese Verdrängung reicht. Statt über Vermögensverteilung, Erbschaften oder Kapitalrenditen zu sprechen, wird die Debatte auf das Verhalten einzelner Gruppen verengt. Rentner sollen „etwas zurückgeben“, Junge „nicht überfordert werden“ – als wäre das Problem eine Frage der Lebensphase, nicht der Systemstruktur.
Dabei ist die eigentliche Konfliktlinie klar:
- Zwischen Kapital und Arbeit
- Zwischen Besitz und Teilhabe
- Zwischen ökonomischer Macht und demokratischer Gestaltung
Dass führende Ökonomen und Politiker diese Linie nicht sehen – oder nicht sehen wollen – ist kein Zufall. Es ist Ausdruck eines Gesellschaftsverständnisses, das sich in der eigenen Anschauung eingerichtet hat und alles andere als „links“ oder „falsch“ abtut.
Fazit: Wer demokratische Zukunft nachhaltig gestalten will, muss Ungleichheit ins Zentrum rücken
Die Debatte um das Pflichtjahr war ein Symptom. Die Krankheit heißt Ungleichheit. Wer heute über Generationengerechtigkeit spricht, ohne über Vermögensverteilung zu reden, betreibt bestenfalls Symptombehandlung – und schlimmstenfalls eine Politik, die soziale Spannungen nicht verhindert, sondern vorbereitet.
Es wird Zeit, die unsichtbare Linie sichtbar zu machen.
Nachtrag, 24.08.2025
Schon einen Tag nach Veröffentlichung meines Beitrags gibt es die Notwendigkeit eines Nachtrages. Der heutige SPIEGEL-Newsletter liefert unfreiwillig das perfekte Beispiel für das, was wir gestern kritisiert haben: Euphemistische Reformrhetorik, die soziale Realität ausblendet und Ungleichheit rhetorisch verklärt. Wer Fratzschers Vorschlag eines Pflichtjahres für Rentner*innen als „Denkanstoß zur Solidarität“ feiert, zeigt vor allem, wie weit sich selbst der Journalismus von den Lebensverhältnissen entfernt hat.
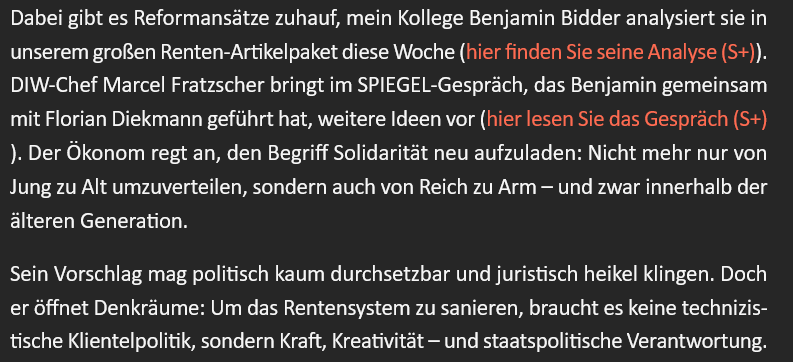
Der heutige SPIEGEL-Newsletter ist ein Lehrstück in diskursiver Vernebelung. Marcel Fratzschers Vorschläge, darunter ein Pflichtjahr für Rentner*innen, werden als Denkanstoß zur „Solidarität innerhalb der älteren Generation“ gefeiert. Das ist Euphemismus in Reinform.
Fratzschers Ideen beschränken sich explizit auf die sozialversicherungspflichtige ältere Bevölkerung – also auf jene, die ohnehin nicht zu den Vermögenden zählen. Und genau das wird im Newsletter auch noch positiv hervorgehoben. Man feiert sozusagen auch noch, dass sich der Vorschlag nicht an die Privilegierten richtet, sondern an jene, die bereits jahrzehntelang gearbeitet haben und nun erneut in die Pflicht genommen werden sollen. Das ist keine „staatspolitische Verantwortung“, das ist das gezielte Ausspielen der Nichtprivilegierten gegeneinander. Der SPIEGEL nennt das „Solidarisierung“.
Diese Art der journalistischen Rahmung zeigt, wie weit selbst etablierte Medien inzwischen vom eigentlichen Problem entfernt sind: der strukturellen Ungleichheit. Statt diese zu benennen und zu bekämpfen, wird sie rhetorisch umgedeutet – als vermeintlich kreative Reformidee. Wer so argumentiert, betreibt keine Aufklärung, sondern verschleiert die Zumutungen einer Politik, die sich nicht an den Vermögenden, sondern an den Belastbaren abarbeitet.
Dass ein solches Framing ausgerechnet im SPIEGEL stattfindet, überrascht – man hätte es eher in der FAZ erwartet. Zwar hat der SPIEGEL auch Ökonomen-Kolumnisten an Bord, deren Ton über die Jahre deutlich neoliberaler geworden ist, aber dennoch galt das Blatt lange als kritischer Gegenpol zu solchen Denkfiguren. Umso irritierender, dass nun auch dort die Umverteilungsidee von unten nach unten als „Denkräume öffnend“ verklärt wird.
Bleibt die Frage: Ist der Journalismus inzwischen genauso weit von den sozialen Realitäten entfernt wie die Politik?

Schreibe einen Kommentar