Heute war ich beim Podcast „Grams‘ Sprechstunde“ bei der sehr geschätzten Dr. Natalie Grams zu Gast – zu meiner Freude schon zum dritten Mal. Heute ging es – nach Zuhörerwunsch – um Schüßler-Salze und Bach-Blüten, ihre Einordnung aus medizinwissenschaftlicher Perspektive und vor allem um ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede untereinander und im Verhältnis zur Homöopathie.… Weiterlesen ...
Schlagwort: Pseudowissenschaftlich
Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog „Die Erde ist keine Scheibe“
und wird hier in leicht überarbeiteter Form wiederveröffentlicht.
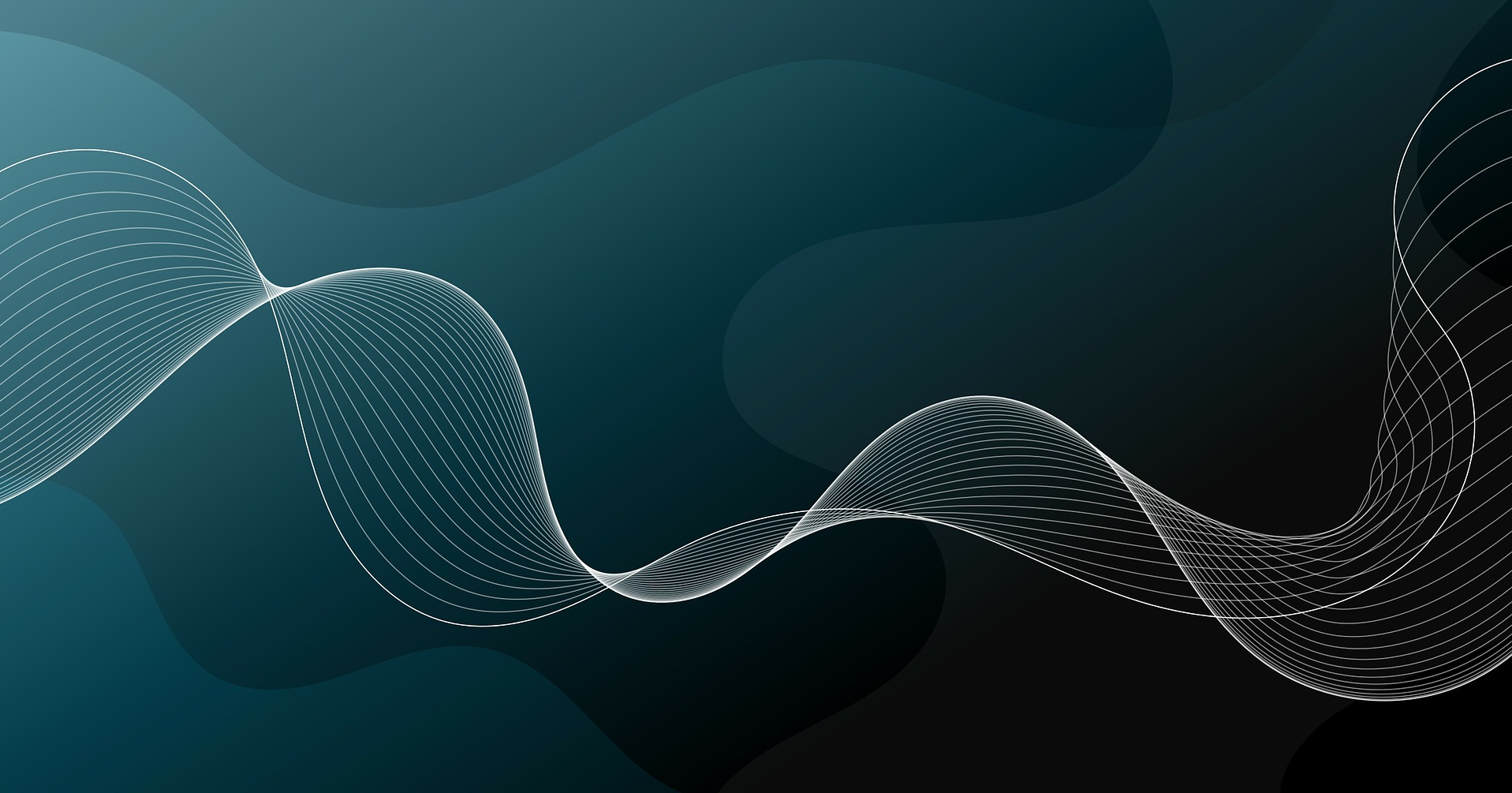
ZUM DEMARKATIONSPROBLEM AM BEISPIEL HOMÖOPATHIE
Die Grenzziehung von Pseudowissenschaft und Wissenschaft, im speziellen Falle von Pseudomedizin und Medizin, ist ein ernsthaft behandeltes Problem der Wissenschaftstheorie. Man beschreibt es mit dem Begriff des „Demarkationsproblems“, auch Abgrenzungsproblem genannt.… Weiterlesen ...
… oder: Einfaches, Falsches und Hypes
Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog „Die Erde ist keine Scheibe“
und wird hier in leicht überarbeiteter Form wiederveröffentlicht.
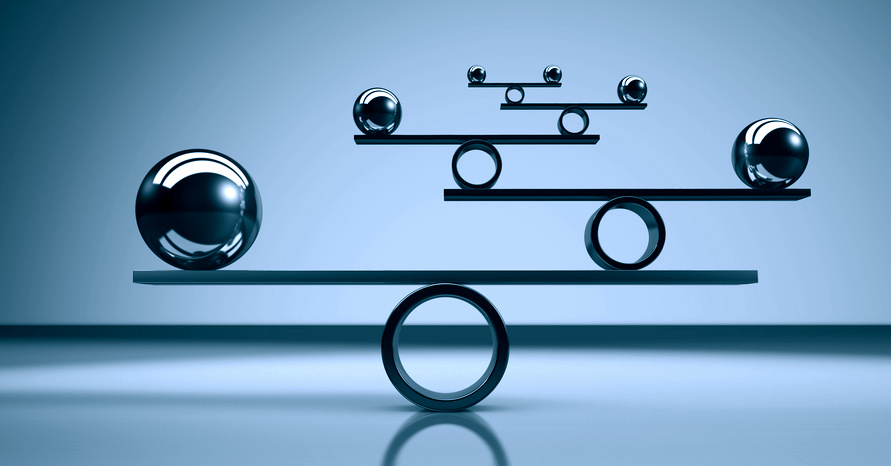
Ganz einfach – oder… ?
Komplex ist eben nicht einfach
In ihrer Untersuchung zu Mitläufereffekten („Bandwagons“ [1]) in der Medizin haben Cohen und Rothschild [2] festgestellt, dass nicht nur Patienten, sondern ebenso Ärzte oft eine neue Idee einfach deshalb akzeptieren, weil sie eben eine neue Idee ist, die Verlockung einer einfachen Lösung für ein komplexes Problem.… Weiterlesen ...

Jetzt weiß ich, was Alternativmedizin ist:
Leider nicht kommentierbar. Deshalb vielleicht auf diesem Wege die Bitte an den Spiegel, künftig das Wort “Alternativmedizin” zu vermeiden und in derartigen Zusammenhängen nur noch von “Pseudomedizin” (oder von Kriminalfällen) zu sprechen.
Der Duden gibt folgende Bedeutungen für “alternativ” an:
… freie, aber unabdingbare Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten; das Entweder-oder;
zweite, andere Möglichkeit; Möglichkeit des Wählens zwischen zwei oder mehreren Dingen
Alternativ in unseren Fällen also die Wahl zwischen bewährter medizinischer Behandlung andererseits, von der schon Millionen profitiert haben, und völlig ungewisser, nicht beurteilbarer Methoden, die zudem richtig teuer sind, auf der anderen Seite.… Weiterlesen ...

