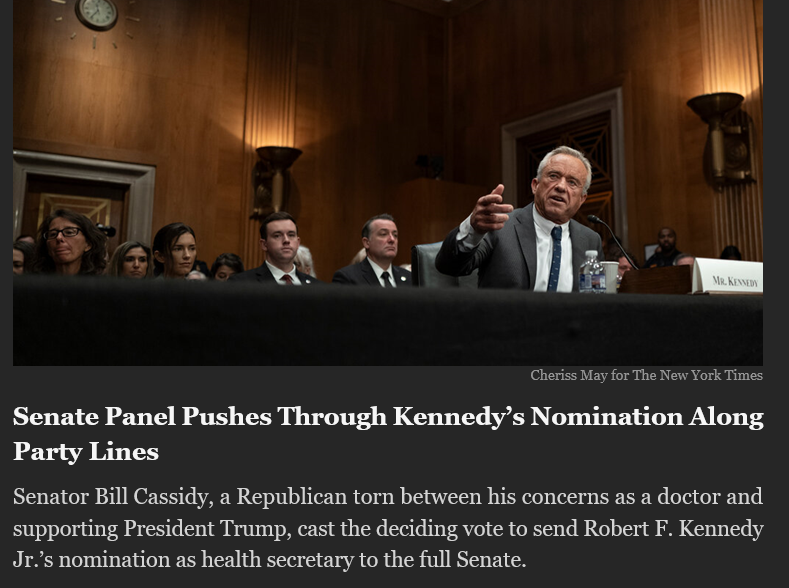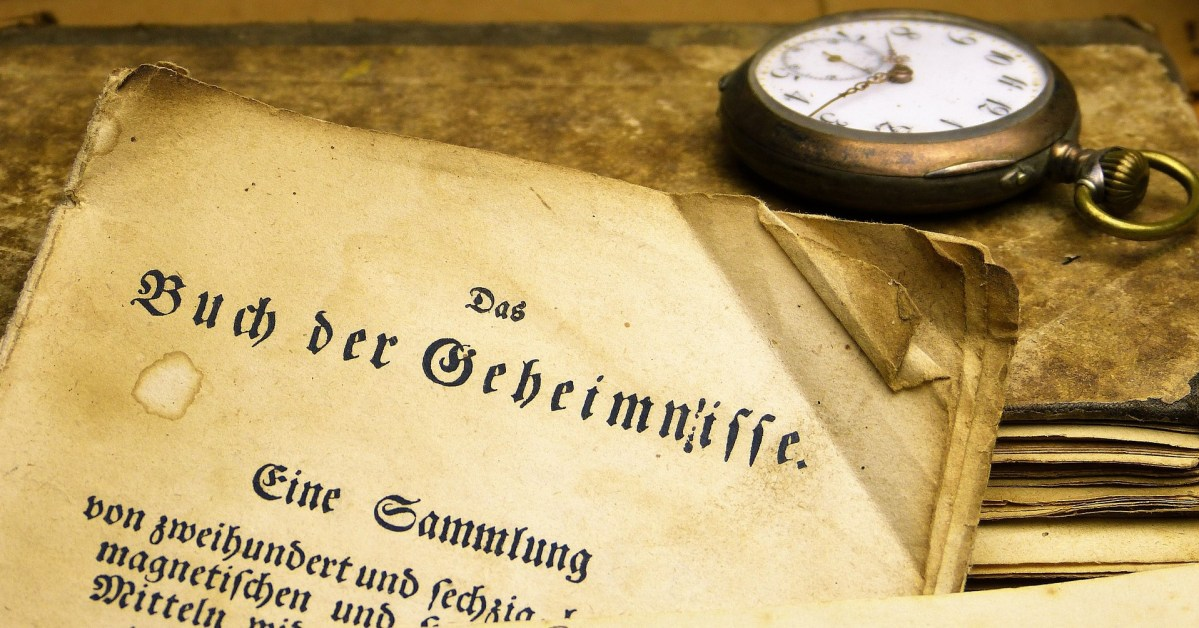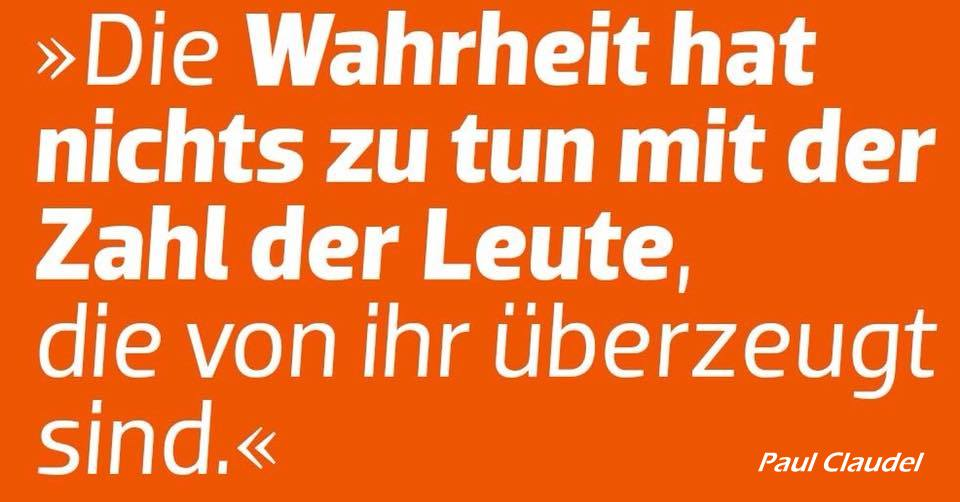Man lacht. Oder man schüttelt den Kopf. Oder beides.
Was RTL diese Woche (Anfang Juni 2025) als „größten Fall“ von Richterin Salesch zur besten Sendezeit in Spielfilmlänge angekündigt hatte, war nicht nur eine neue Folge dieser pseudo-juristischen Unterhaltungssendung – es war ein mediales Trauerspiel. Und es zeigt, wie weit sich Unterhaltung vom Anspruch entfernt hat, wenigstens nicht aktiv zu verdummen.… Weiterlesen ...