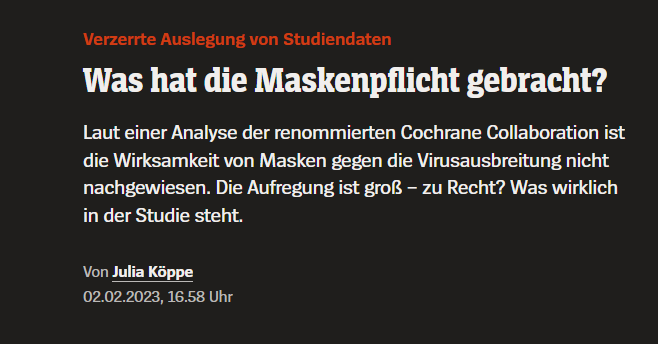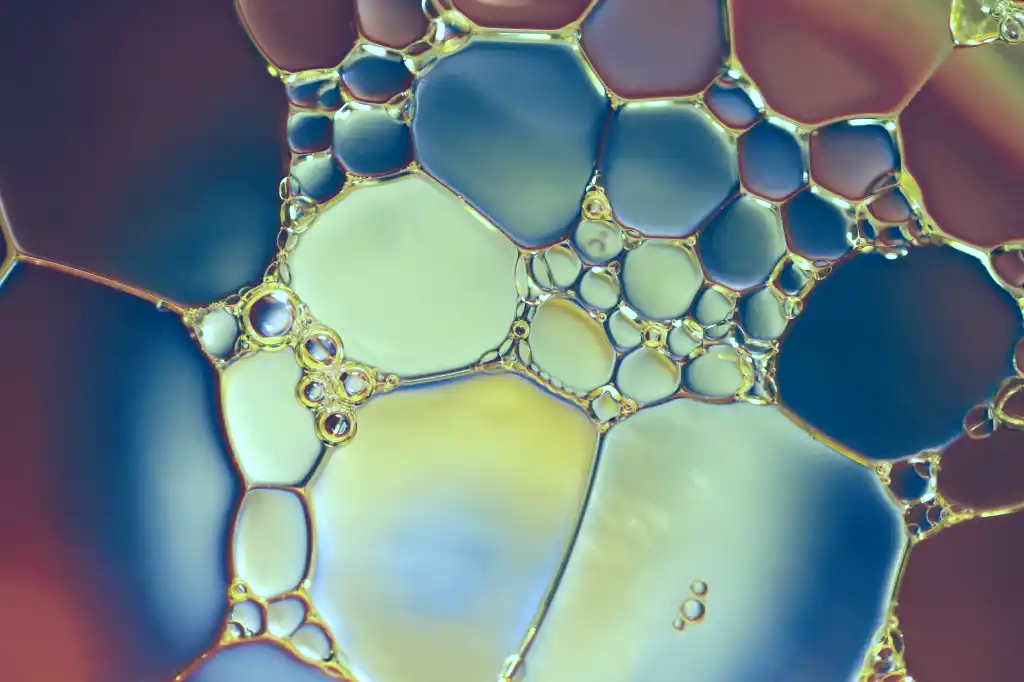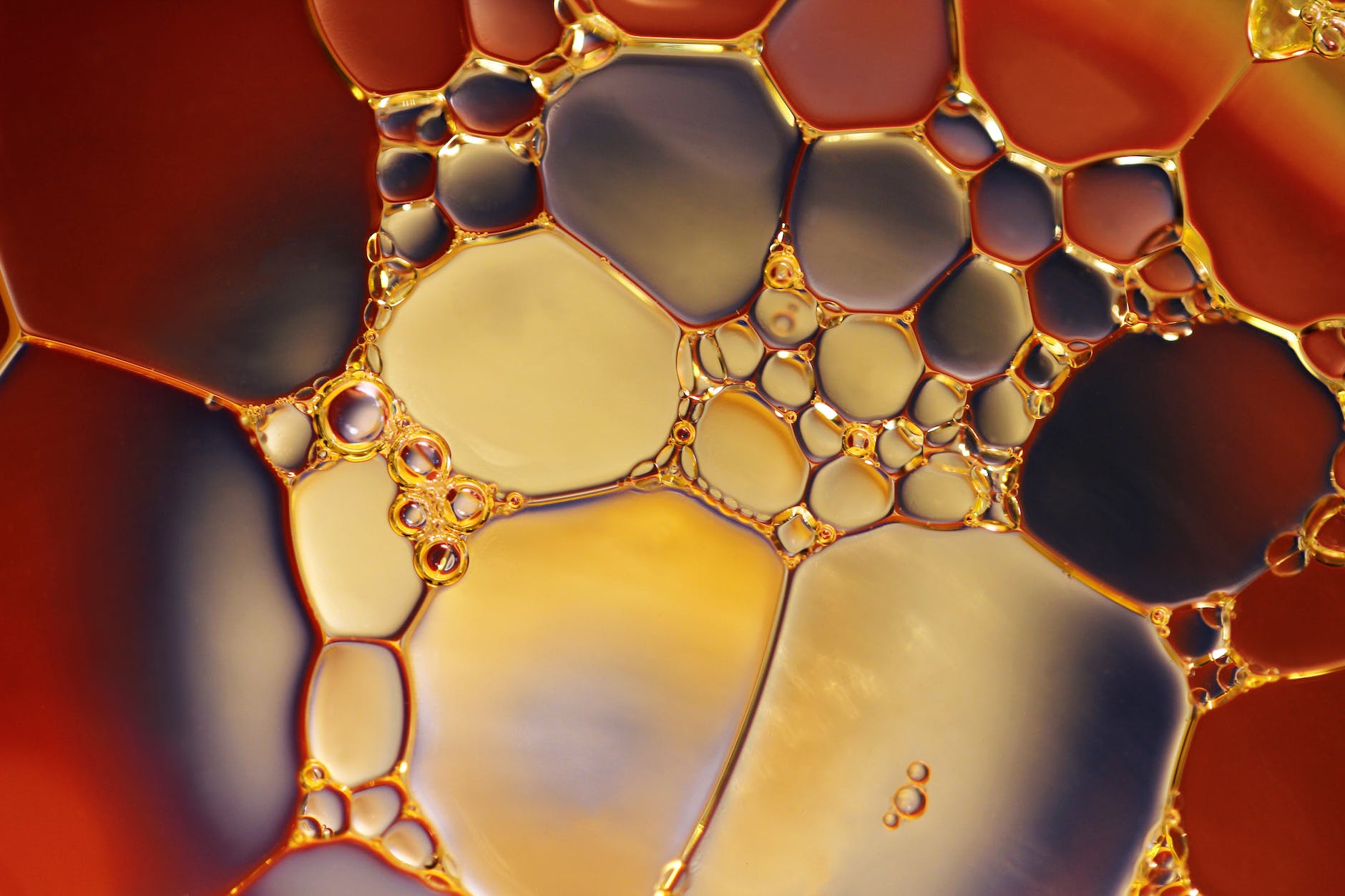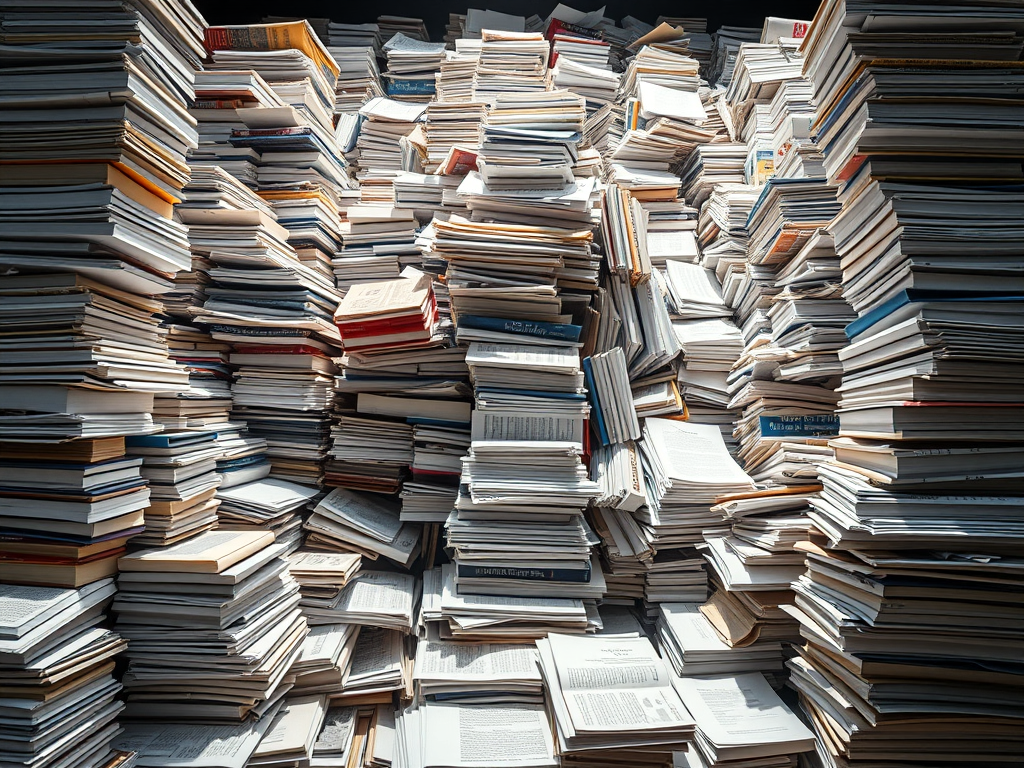
Ich bin ja nur ein kleiner Blogger, der allerdings auch selbst schon wissenschaftlich veröffentlicht und ein Auge auf Tendenzen im Wissenschaftsbetrieb hat. Letzteres ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Warum – dazu stelle ich heute einmal einen wichtigen Teilaspekt vor, die wissenschaftliche Publikationspraxis. Da sehe ich allerlei Düsternis.… Weiterlesen ...