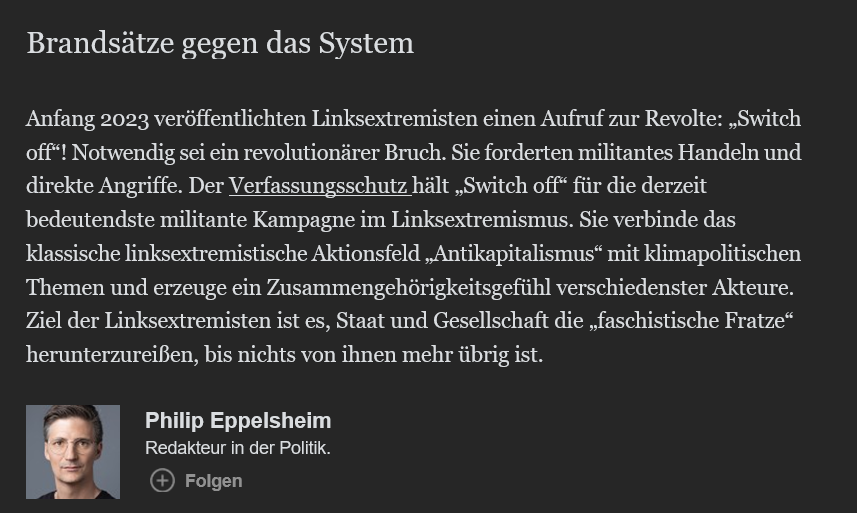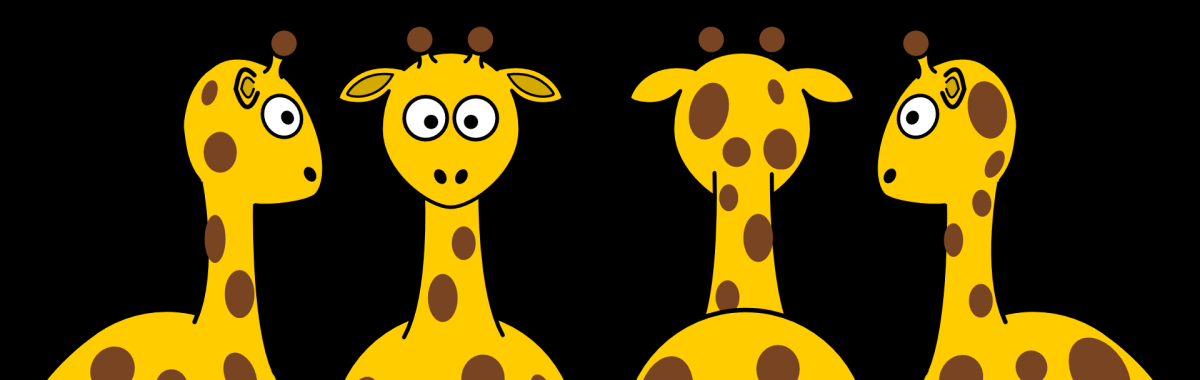DB Cargo zwischen Markt und Mythos
Die Entlassung der Spartenchefin von DB Cargo richtet den Fokus erneut auf dieses „Problemkind“ der Deutschen Bahn. Und da sollte man sich einen klaren Blick bewahren.
Das Dilemma von DB Cargo lässt sich nur verstehen, wenn man den Güterverkehr als das betrachtet, was er tatsächlich ist – kein Bereich klassischer Daseinsvorsorge, sondern ein marktwirtschaftlich organisierbarer Sektor industrieller Logistik.… Weiterlesen ...