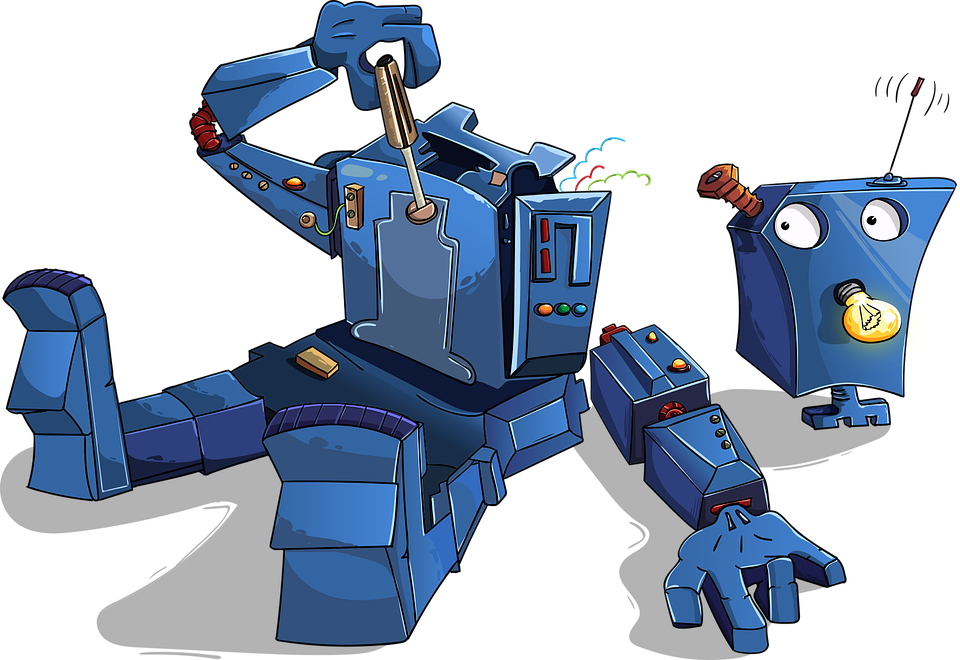
In Gesprächen und anderen Rückmeldungen auch zu diesem Blog konnte ich feststellen, dass vielen Interessenten aber jenseits vieler Einzelthemen der konzentrierte Überblick über die Frage, was Homöopathie denn eigentlich sei und wo die “Knackpunkte” liegen, doch fehlt.
Ich möchte die freundlichen Anregungen gern aufnehmen und an dieser Stelle einen solchen konzentrierten Überblick liefern.
Also, auf geht’s. Wir stützen uns hier auf die Hahnemannsche Lehre, wie er sie in seinem Organon der Heilkunst niedergelegt hat. Die Verwicklungen und Verirrungen seiner Exegeten bis heute, die -nach den Worten des gern zitieren Prof. Otto Prokop- “gescheiterten Versuche, durch Angleichung des homöopathischen Systems an die Schulmeinungen an den Universitäten allgemeine Anerkennung zu erlangen”, waren teilweise schon Gegenstand in diesem Blog und werden auch später noch genauer beleuchtet und entzaubert werden. Einen hervorragenden Beitrag dazu hält übrigens die Homöopedia bereit.
Was ist Homöopathie?
Homöopathie ist nach Hahnemanns eigenen Vorstellungen eine Arzneimittellehre (keine Naturheilkunde, keine Gesprächstherapie im Sinne einer „Psychotherapie light“), die gar nicht den Anspruch erhebt, “Krankheiten” heilen zu wollen. “Heilen” als homöopathischer Begriff bezieht sich auf den Patienten, nicht auf Krankheiten. Ärgerlicherweise wird dieser Umstand immer als Beleg für die “Ganzheitlichkeit” (was ist das?) der homöopathischen Methode herangezogen. Nichts könnte falscher sein. Hahnemanns Methode ist rein symptombezogen, er strebte an, eine von ihm angenommene “verstimmte geistige Lebenskraft”, die sich durch Symptome – und nur durch Symptome! – bemerkbar macht, per Arzneimittelgabe wieder richtig zu “stimmen” und damit den Patienten zu “heilen”.
Woraus sich die Frage ergibt,
Wie sieht die Homöopathie Krankheiten?
Nach Hahnemann kann niemand außer den von außen erkennbaren Symptomen etwas über die “Krankheit” eines Patienten wissen, denn sie ist ja die “Verstimmung” der individuellen (wichtig!) “geistigen Lebenskraft” des Patienten. Logischerweise benannte Hahnemann auch keine Krankheiten, er leugnete stets das Konzept „typisierter“ Krankheiten und bestand auf seiner Vorstellung der individuell verstimmten Lebenskraft. Daher kam es ihm (nur) darauf an, mit größtmöglicher Genauigkeit ein Gesamtbild der Symptome, im wörtlichen Sinne das individuelle “Symptombild” des Patienten zu ermitteln – ein Bild der Verstimmung der “geistigen Lebenskraft”. Über die Ursachen von Krankheiten äußerte Hahnemann sich nicht, dies war für ihn unwesentlich.
Deshalb ist es geradezu grotesk, von der Homöopathie als einer “ursachenbeseitigenden” und von der wissenschaftlichen Medizin als einer “nur symptombekämpfenden” Methode zu sprechen. Der umgekehrte Fall trifft zu. Leicht erklärbar wird diese seltsame Behauptung der Homöopathen dann, wenn man bedenkt, dass sie die „verstimmte geistige Lebenskraft“ als „Ursache“ von Krankheiten sehen und nicht etwa eine Infektion oder einen organischen Schaden. Was ein bezeichnendes Licht auf das Verhältnis von Homöopathie und wissenschaftlicher Medizin wirft. Wo sollte wohl hier ein Ansatz zu einer oft beschworenen „Zusammenarbeit zum Wohle des Patienten“ liegen?
Auf welche Weise soll die “verstimmte geistige Lebenskraft” wieder korrigiert werden?
Durch Hahnemanns Arzneimittellehre, die sich auf eine zentrale Grundannahme stützt: das Ähnlichkeitsprinzip, das niemals belegte esoterisch fundierte Postulat, dass “Ähnliches durch Ähnliches” geheilt werden könne. So sucht die “Arzneimittelprüfung”, der “Blindtest” von allen möglichen Substanzen, organischer wie anorganischer und selbst „immaterieller“ wie Licht, Strahlung usw. (sog. Imponderabilien), an Gesunden Symptome, die nach der Einnahme auftreten. Gefahndet wird dabei nach allen nur denkbaren Erscheinungen beim Probanden, auch den kleinsten, die nach der Einnahme der homöopathischen Stoffe auftreten – in der Regel innerhalb von fünf Tagen (tut sich bis dahin nichts, hat man keine irgendwie geeignete Substanz erwischt). Aber häufig schaut man noch viele Tage, gar Wochen, danach, man will ja nichts „übersehen“. Daraus leitet man die Arzneimittelbilder ab, die die Grundlage für die Behandlung ähnlicher Symptombilder beim Kranken herangezogen werden. Die Sammlung dieser Ergebnisse stellen die “Materiae medicae” der Homöopathen dar, Verzeichnisse der den Mitteln zugeordneten Symptombilder. Die Mittel und ihre Symptombilder – also die umgekehrte Systematik – werden in sogenannten Repertorien gesammelt, die in der therapeutischen Praxis der Mittelfindung dienen.
Angesichts heutiger Erkenntnisse liegt auf der Hand, dass Krankheit nicht mit Symptom gleichgesetzt werden kann. Vergegenwärtigt man sich nur die simple Alltagserfahrung, muss dieses Hahnemannsche Dogma doch absonderlich erscheinen. Eine Lebensmittelvergiftung mag die gleichen Symptome hervorrufen wie ein Magenkarzinom eines bestimmten Stadiums. Wie will der Homöopath behandeln? Da er nur die Symptome sieht, mag er zu dem Ergebnis kommen, dass in beiden Fällen die Gabe beispielsweise von homöopathisch aufbereitetem verdorbenem Fleisch (das gibt es!) als Simile, also als “symptomenähnliches” Mittel, anzuraten sei. So sähe die Praxis aus. Noch Fragen?
Ebenso kann ein und dieselbe Erkrankung bei verschiedenen Patienten durchaus unterschiedliche Symptombilder hervorrufen.
Zudem ist die Arzneimittelprüfung völlig subjektiv (obwohl die Homöopathen glauben, gerade die Arzneimittelprüfung sei der „wissenschaftliche“ Teil ihrer Methode). Aus dem gleichen Versuch an Gesunden gehen -zwangsläufig, da nicht ursächlich mit der Mittelgabe verknüpft- alle möglichen Symptombilder hervor. Alles wird gesammelt und in der Materia Medica zusammengefasst. Wo soll da noch eine verlässliche Basis sein?
Die umfangreichen Studien von Prof. Paul Martini, dem nachmaligen Präsidenten der Gesellschaft für Innere Medizin, haben mit unterschiedlichsten Untersuchungsmethoden ein klares Ergebnis erbracht: Die Ergebnisse der Hahnemannschen Arzneimittelprüfungen sind wertlos.
Das führt uns zur
Homöopathischen Anamnese
als der entscheidenden Säule für die homöopathischen Therapie. Ihre Basis ist das vielgelobte therapeutische Gespräch beim Homöopathen. Dies wird aber keineswegs mit dem Ziel einer persönlichen Zuwendung mit besonderer Empathie dem Patienten gegenüber geführt, wenn dieses Empfinden auch sicher eine wesentliche Bedingung für den homöopathischen “Heilerfolg” und den “guten Ruf” der Methode ist. Das Zuhören und gegebenenfalls das ergänzende “Ausfragen” mag subjektiv beim Patienten den Eindruck der persönlichen Zuwendung und des Interesses erwecken, es hat aber einen völlig anderen Zweck. Die homöopathische Anamnese stellt sozusagen das Spiegelbild der Arzneimittelprüfung am Gesunden dar, denn sie ist darauf aus, ein Symptombild ausfindig zu machen, das mit einem (oder mehreren) Symptombildern aus den Repertorien in Deckung gebracht werden kann. Geschieht dies – die Leistung dabei ist eher eine gedächtnis- oder auch computertechnische – so hat man das „Gegenmittel“ gefunden.
Eine sehr feinsinnige gedankliche Konstruktion auf der Basis der Ähnlichkeitsregel, zweifellos. Aber eben nur eine Verfeinerung einer aus vorwissenschaftlichen Zeiten stammenden, magischem Denken angehörenden Vorstellung mit Wurzeln in der Frühantike. Die Ähnlichkeitsregel der Homöopathie konnte nie bewiesen werden. Schon Hahnemanns nie erfolgreich reproduzierter Chinarindenversuch, auf der seine „Entdeckung“ des Ähnlichkeitsprinzips fußt, ist aber viel eher eine Widerlegung der Regel: Niemals konnte beobachtet werden, dass Chinin Malariasymptome hervorruft. Weder als Urstoff noch als Verdünnung. Zudem wird kaum jemand ernsthaft annehmen, dass z.B. eine Vergiftung durch die weitere Gabe des Giftes – verdünnt oder nicht – behoben werden könnte. Oder eine akute Infektion durch eine Erhöhung der Erregerzahl. Die Beispiele sind Legion. Die sachlogischen Argumente dagegen ebenfalls.
Man bedenke: Mit der Ähnlichkeitsregel steht und fällt das Hahnemannsche Gedankengebäude! Nicht erst mit dem so augenfällig absurden Potenzierungsprinzip. Obwohl selbst das Ähnlichkeitsprinzip bereits von Hahnemannschen Exegeten relativiert wurde, als die Brüchigkeit des Gebäudes nicht mehr zu leugnen war.
Aber wie verhält es sich denn mit dieser sogenannten
Potenzierung?
Erst einmal die -offenbar notwendige- Klarstellung: Die Homöopathie benutzt den Begriff entgegen dem normalen Wortsinn, der ja eine Steigerung, eine Erhöhung bezeichnet. Die Potenzierungsmethode der Homöopathie ist jedoch eine massive Verdünnung des Wirkstoffs in einem Lösungsmittel. Sie will mit dem Begriff der Potenzierung zum Ausdruck bringen, dass die geringere Lösungskonzentration eine immer höhere Wirksamkeit entfalte, wenn sie nach homöopathischen Ideen potenziert wird. Hahnemann verband mit der Potenzierung nicht nur die reine Verdünnung, er verlangt rituelle Herstellungsvorschriften: Statt einfacher Verdünnung “Potenzierung” in Zehner- oder Hunderterschritten, Verreiben und Verschütteln der Ursubstanz, mittels Schlagen der verdünnten Lösungen in bestimmter Art und Zahl auf bestimmte Untergründe…Er warnte bei einigen Mitteln sogar davor, dass zwanzig Schüttelschläge ein tödlich wirkendes Gift, zehn aber die gewünschte Medizin ergeben würden.
Wobei die Kernthese Hahnemanns ist, dass eine Arznei umso intensiver wirkt, desto höher sie “potenziert” wird. Er warnte ausdrücklich vor dem unvorsichtigen Umgang mit Hochpotenzen, die er bei falscher Anwendung geradezu für tödliche Mittel hielt. Gegen Ende seines Lebens erwog er sogar noch eine ungeheure Erweiterung der Potenzierungsgrade über das bislang Übliche hinaus – wobei selbst dieses “Übliche” bereits Verdünnungen erreichte, die einem Stück Würfelzucker auf das Volumen des beobachtbaren Universums entsprachen. Überastronomisch, könnte man sagen.
Hier wird noch einmal die Nähe Hahnemanns zu vorwissenschaftlichen, mystischen Vorstellungen deutlich. Er selbst war auch Chemiker, für seine Zeit kein schlechter. Trotzdem ging er – wenn auch nicht gleich zu Anfang – von der Richtigkeit seiner Potenzierungslehre aus. Das ist nur dadurch zu erklären, dass er wirklich nicht von einer physiologischen Wirkung, also einer Wechselwirkung zwischen Substanz und menschlichem Körper ausging, sondern ernsthaft glaubte, es ginge um die Beeinflussung der “geistartigen Lebenskraft”, bei der eine Wirkung der ebenfalls “geistigen Kräfte” des eingesetzten Mittels – wobei die extreme Potenzierung dem (würde man heute in Eso-Kreisen sagen) “feinstofflichen Wirkungsmechanismus” eben angemessen sei.
Die Behauptung der Wirksamkeit solcher “potenzierten Arzneien”, bei denen sich ab einer bestimmten – schon recht niedrigen – Verdünnung mehr Lösungsmittelverunreinigungen als Ursubstanz in der Lösung befinden, irgendwann die Nachweisgrenze des Urstoffs überschritten wird und ab einer Verdünnung von 1023 (auch weit höher durchaus üblich) keine Moleküle der Ursubstanz mehr in der Lösung vorhanden sind, ist eine der hauptsächlichsten Bemühungen der “homöopathischen Forschung”. Vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute. Außer Behauptungen, das Problem sei gelöst (die gab es schon um 1840…) gab es aber nichts Substanzielles. Das hat auch niemand, der mit physikalisch-chemischen und pharmakologischen Grundlagen vertraut ist, erwartet.
Und wenn’s nicht hilft?
Dann hat man doch noch nicht das richtige Mittel gefunden und setzt ein anderes an (die Repertorien sind ja dick genug…). Oder der Patient hat bei der Einnahme einen Fehler gemacht, entweder nicht richtig eingenommen oder etwas “Schädliches” zu sich genommen, das die homöopathische Wirkung behindert. Möglicherweise ist der arme Patient auch von der “Schulmedizin” vorher schon so traktiert worden, dass die Homöopathie nicht mehr hilft. Was dann gern mit einer Rücküberweisung zur “Schulmedizin” quittiert wird. Man sieht, Misserfolge der Homöopathie kann es praktisch gar nicht geben. Zudem lässt die homöopathische Therapie den Krankheiten Zeit genug, sich abzuschwächen oder gar ganz zu verschwinden. Das tun nämlich gut und gerne achtzig Prozent der akuten Krankheiten eh.
Also eine eher “lexikalische” als medizinische Methode, aufbauend nicht auf Plausibilität und belastbarer Empirie, sondern ausschließlich als Gedankengebäude auf der Grundlage unhaltbarer Axiome und Spekulationen. Kurz gesagt – Nix drin, nix dran.
Die Kunst des Schreibens besteht bekanntlich im Weglassen. Was mir oft schwerfällt. Ich hoffe, die Mühe des Weglassens von näheren Erläuterungen und Abschweifungen macht diesen kleinen Beitrag zu einem informativen Quell für alle, die bislang nicht, nur unvollständig oder falsch über die Grundlagen der Homöopathie informiert waren – und bereit sind, sich mit der Kraft ihres Verstandes unvoreingenommen mit ihr auseinanderzusetzen. Sapere aude!
Zum Weiterlesen: Homöopathie – Wunderglaube?

Schreibe einen Kommentar