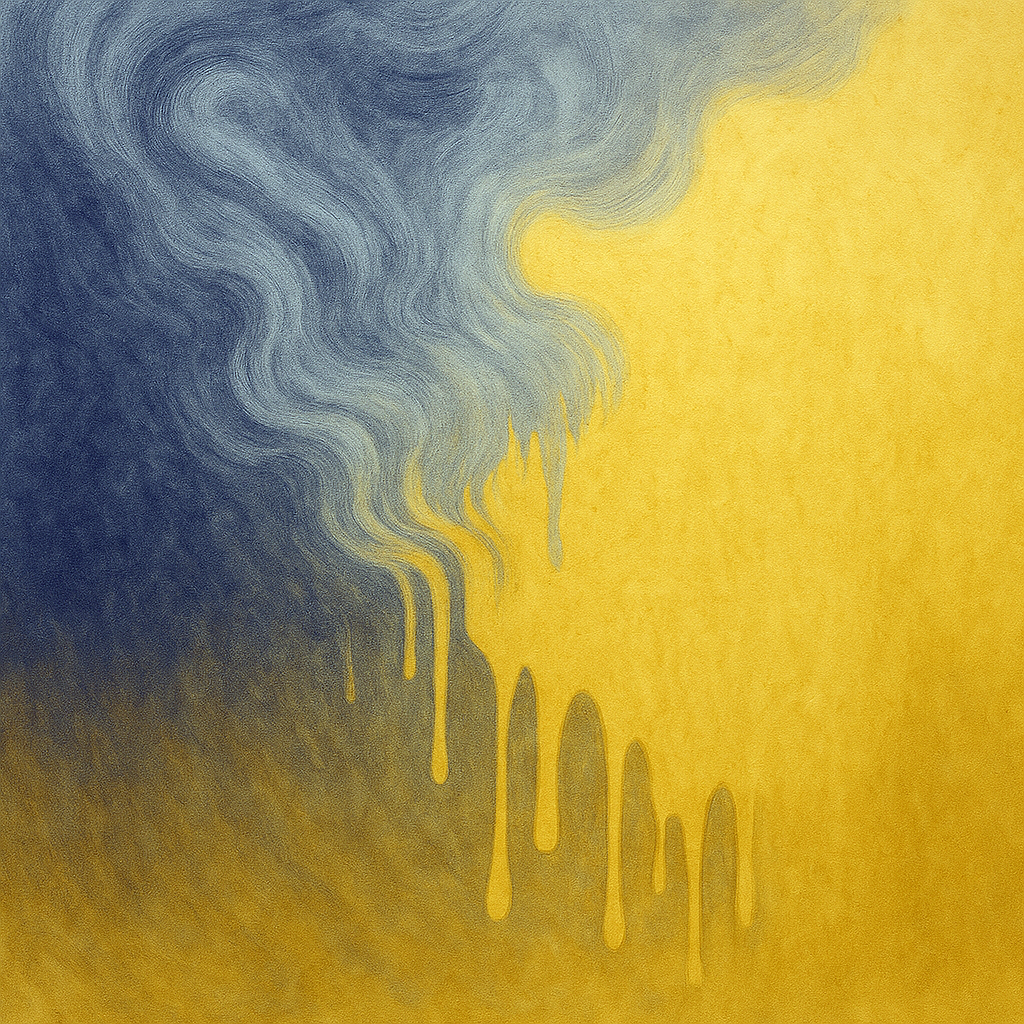In einem früheren Beitrag habe ich auf Basis von Berichten in der Berliner Zeitung und im Handelsblatt über vermeintliche Kürzungen im Bundeshaushalt für ME/CFS-Forschung geschrieben. Die Schärfe meiner Kritik bezog sich auf die politische Signalwirkung und die Sorge vieler Betroffener, dass die dringend benötigte Forschungs- und Versorgungsoffensive ins Stocken geraten könnte.… Weiterlesen ...