Wie die Union die Linke ächtet und die Geschichte vergisst
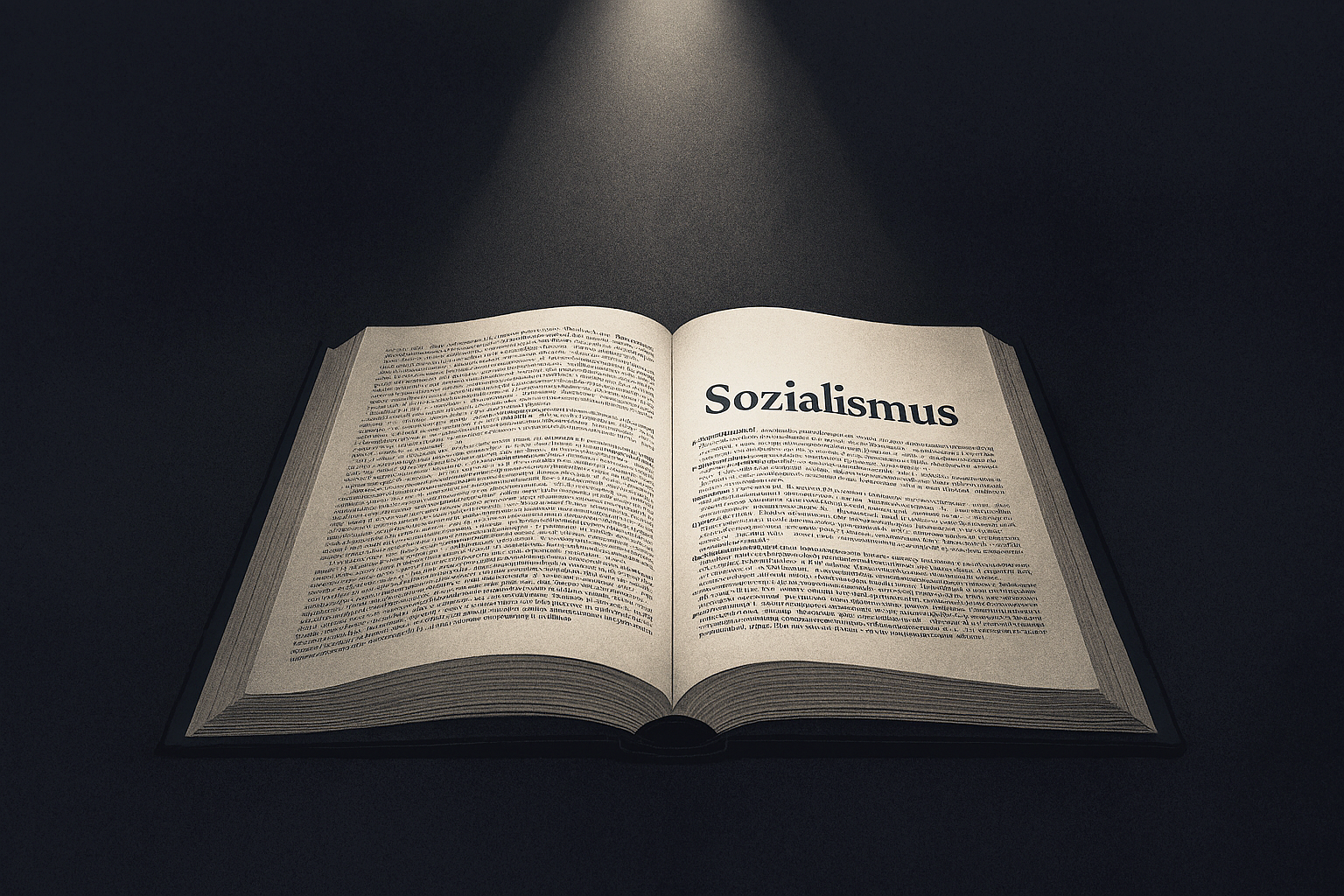
„Sozialismus“ – ein Gespenst ohne Begriff
Ich habe meinen Studierenden einmal eine scheinbar einfache Aufgabe gestellt: „Beschreiben Sie die Wirtschaftsform im Sozialismus.“ Die meisten scheiterten – und lagen damit richtig. Denn wer diese Frage beantworten will, muss zunächst wissen, dass es keine einheitliche, historisch konkretisierte Wirtschaftsform des Sozialismus gibt. Marx und Engels haben nie ein ökonomisches Modell entworfen, das man als „sozialistische Wirtschaft“ bezeichnen könnte. Ihre Vorstellung war kulturanthropologisch, nicht technokratisch: eine Bewegung hin zur klassenlosen Gesellschaft, getragen von Bewusstseinswandel, nicht von Planvorgaben.
Und doch wird der Begriff „Sozialismus“ heute in der politischen Debatte inflationär und verzerrt verwendet – meist als Schreckbild, als Etikett für alles, was nach Umverteilung, Gerechtigkeit oder staatlicher Verantwortung klingt – nach „links“ irgendwie. Besonders deutlich wird das im Umgang mit Politiker:innen der Linken, etwa Heidi Reichinnek, die jüngst zur Projektionsfläche konservativer Empörung wurde. Mit der üblichen Rhetorik – joviale Anerkennung ihres persönlichen Engagements bei gleichzeitiger Ausgrenzung aus dem Diskurs wegen – ja wegen „Sozialismus“. Die Union hält ihren Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber der Linken aufrecht, während die sogenannte Brandmauer zur AfD taktisch durchlässig gemacht wird. Das ist keine Verteidigung der Mitte – das ist semantische und strategische Schieflage.
Was Sozialismus historisch meint – und was nicht
Wer heute das Wort „Sozialismus“ hört, denkt oft reflexhaft an Planwirtschaft, Verstaatlichung, Gleichmacherei. Doch diese Assoziationen sind politisch aufgeladen und historisch verkürzt. Marx und Engels haben nie ein konkretes Wirtschaftsmodell entworfen, das als Blaupause für einen sozialistischen Staat dienen könnte. Ihre Vorstellung war kulturanthropologisch: eine historische Bewegung, die durch die Emanzipation der Arbeiterklasse zur klassenlosen Gesellschaft führen sollte – nicht durch technische Steuerung, sondern durch Bewusstseinswandel und soziale Praxis.
Der Sozialismus war für sie kein fertiges System, sondern ein Entwicklungsprozess, der aus den Widersprüchen des Kapitalismus hervorgehen sollte. Die Idee war nicht Gleichheit im Sinne von Nivellierung, sondern Freiheit durch Aufhebung von Ausbeutung und Entfremdung. Dass spätere Regime diese Vision in autoritäre Staatswirtschaften überführten, war eine politische Entscheidung – keine theoretische Notwendigkeit.
Die Sozialdemokratie war die historische Antwort auf diese Utopie. Sie versuchte, den Prozess der sozialen Emanzipation institutionell zu kanalisieren, ohne revolutionären Bruch, ohne Diktatur des Proletariats. Nicht erst das Godesberger Programm markiert die Abgrenzung der SPD von revolutionären und autoritären Modellen und marxistischen Dogmen – ohne dabei das Ziel einer gerechten Gesellschaft aufzugeben. Schon die Abspaltung der USPD 1917, die Ablehnung der Rätebewegung und die bewusste Entscheidung für parlamentarische Reform markieren den Weg zur Domestizierung der marxistischen Utopie. Das Godesberger Programm war also nicht der Beginn, sondern die Bekräftigung einer Entwicklung, die aus Verantwortung und Konflikt geboren wurde. Der „demokratische Sozialismus“ wurde zum ethischen Leitbild, nicht zur ökonomischen Vorschrift.
Bis heute führt die SPD diesen Begriff im Parteiprogramm – und niemand käme auf die Idee, sie deshalb mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss zu belegen. Dass die Linke hingegen pauschal als „sozialistisch“ diskreditiert wird, zeigt nicht nur eine semantische Unschärfe, sondern eine strategische Verzerrung: Es geht nicht um Begriffe, sondern um politische Ausschlussmechanismen.
Was Kommunismus meint – und woher er kommt
Kaum erklärt man, was Sozialismus historisch bedeutet, steht sofort der Kommunismus im Raum – als rhetorisches Gespenst, als vermeintliche Konsequenz, als Schreckbild. Doch auch hier gilt: Wer den Begriff benutzt, sollte wissen, wovon er spricht.
Der Kommunismus ist nicht die Fortsetzung des Sozialismus, sondern eine eigenständige politische Idee mit anarchistischen Wurzeln. Schon im 19. Jahrhundert wurde er in oppositionellen Milieus entwickelt, die sich gegen jede Form von Staatlichkeit wandten – auch gegen die sozialistische Vorstellung eines geregelten Übergangs zur klassenlosen Gesellschaft. Lenin selbst war ein Grenzgänger zwischen marxistischer Theorie und anarchistischer Praxis. Seine Interpretation des Kommunismus war autoritär, zentralistisch, revolutionär – und hatte mit der kulturanthropologischen Vision von Marx und Engels nur noch wenig gemein.
Der Kommunismus, wie er sich in der Sowjetunion und später in anderen Staaten manifestierte, war eine politische Konstruktion, nicht eine theoretische Notwendigkeit. Er setzte auf Gleichmacherei, auf die Abschaffung von Privateigentum, auf die Kontrolle aller Lebensbereiche durch den Staat. Und er tat dies oft unter dem Deckmantel der historischen Mission – mit verheerenden Folgen für Freiheit, Vielfalt und Menschenwürde.
Wer heute den Begriff „Sozialismus“ verwendet, um diesen über Gleichsetzung mit solchen kommunistischen Systemen zu diskreditieren, betreibt semantische Irreführung. Sozialismus ist nicht Kommunismus. Und wer beides gleichsetzt, verhindert nicht nur politische Aufklärung – er verhindert demokratische Debatte.
Semantische Verantwortungslosigkeit – Wenn politische Sprache Geschichte vergisst
Es wäre leicht, die Unwissenheit konservativer Politiker:innen über die historischen und theoretischen Grundlagen von Sozialismus und Kommunismus als bloße Bildungslücke zu belächeln. Doch sie ist mehr als das: Sie ist eine Form politischer Verantwortungslosigkeit, die den öffentlichen Diskurs verzerrt und demokratische Maßstäbe untergräbt.
Wenn führende Vertreter der Union den Begriff „Sozialismus“ verwenden, um die Linke zu diskreditieren, ohne zwischen ihr, Marx, Engels, Lenin, Sowjetunion, DDR und auch der SPD zu unterscheiden, dann ist das keine politische Kritik, sondern semantische Nebelwerfer-Taktik. Sie ersetzt Argumente durch Etiketten, Geschichte durch Schlagworte, Differenzierung durch Alarmismus.
Und das Problem beschränkt sich nicht auf die Union. Auch in sozialdemokratischen Reihen fehlt oft das Bewusstsein für die eigene ideengeschichtliche Herkunft. Viele wissen nicht, dass der „demokratische Sozialismus“ im Parteiprogramm der SPD eine bewusste Abgrenzung von autoritären Modellen darstellt – und zugleich eine ethische Verpflichtung zur sozialen Gerechtigkeit. Wer diesen Begriff führt, sollte ihn auch verstehen.
Die Folge dieser semantischen Verwahrlosung ist fatal:
- Die Linke wird pauschal als „sozialistisch“ etikettiert, ohne begriffliche Klärung.
- Die SPD wird von ihrer eigenen Geschichte entfremdet.
- Die AfD wird relativiert, weil man sich rhetorisch auf die „linke Gefahr“ konzentriert.
Das ist keine Verteidigung der Mitte – das ist eine semantische und politische Schieflage, die den demokratischen Kompass verliert.
Diffamierung statt Differenzierung – Die Union und das Sozialismusgespenst
Die pauschale Ächtung der Linken durch die Union mit dem Verweis auf deren „sozialistische“ Ausrichtung ist keine politische Analyse – sondern eine semantische Kurzschlussreaktion, die historische Komplexität durch parteitaktische Vereinfachung ersetzt. Es handelt sich um eine intellektuelle Fehlleistung, weil sie zentrale Unterschiede zwischen Sozialismus, Kommunismus, Sozialdemokratie und autoritären Staatswirtschaften ignoriert. Und es ist eine politisch gewollte Diskursverzerrung, weil sie nicht auf Klärung zielt, sondern auf Ausschluss.
Diese Strategie funktioniert nur, weil der Begriff „Sozialismus“ in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr historisch differenziert, sondern emotional aufgeladen ist. Wer ihn verwendet, aktiviert Assoziationen von DDR, Mangelwirtschaft und Gleichmacherei – unabhängig davon, ob sie sachlich zutreffen. Die Union nutzt diesen Effekt, um die Linke zu delegitimieren, ohne sich mit deren tatsächlichen programmatischen Inhalten auseinanderzusetzen.
Das ist nicht nur unfair gegenüber der Linken. Es ist auch gefährlich für die demokratische Debatte. Denn wer politische Begriffe als Kampfbegriffe benutzt, verhindert Verständigung. Und wer die Linke, eine Partei, die sich klar zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt, pauschal ausgrenzt, relativiert zugleich die reale Gefahr von rechts – etwa durch rhetorische Entlastung der AfD.
Die Diffamierung des Sozialismusbegriffs ist also mehr als ein rhetorischer Trick. Sie ist ein Symptom für den Verlust semantischer Verantwortung in der Politik. Und sie zeigt, wie dringend wir eine Renaissance der politischen Bildung brauchen – nicht als Schulfach, sondern als republikanische Kulturtechnik.
Fazit: Wer Begriffe nicht versteht, sollte sie nicht benutzen
Was bleibt, ist eine nüchterne Erkenntnis: Die politische Sprache unserer Gegenwart leidet unter semantischer Verwahrlosung. Begriffe wie „Sozialismus“ und „Kommunismus“ werden nicht erklärt, sondern instrumentalisiert. Sie dienen nicht der Klärung, sondern der Abgrenzung. Und sie werden von Politiker:innen verwendet, die ihre historische Tiefe nicht kennen – oder bewusst ignorieren.
Das ist nicht nur intellektuell ärgerlich. Es ist demokratiepolitisch gefährlich. Denn wer Begriffe entleert, entleert auch die Debatte. Wer die Linke pauschal ächtet, weil sie angeblich „sozialistisch“ sei, ohne den Begriff zu klären, betreibt keine politische Kritik – sondern rhetorische Ausgrenzung. Und wer gleichzeitig die AfD relativiert, weil man sich auf die „linke Gefahr“ konzentriert, verliert den Kompass.
Ich erhebe meine Stimme nicht, weil ich mich einem Lager verpflichtet fühle. Ich erhebe sie, weil ich semantische Verantwortung für eine republikanische Öffentlichkeit einfordere. Weil ich glaube, dass Demokratie von Klarheit lebt – nicht von Etiketten. Und weil ich weiß, dass politische Begriffe nicht beliebig sind, sondern Ausdruck von Geschichte, Haltung und Verantwortung.
Wer das nicht versteht, sollte schweigen. Oder lernen. Denn wer Begriffe nicht versteht, sollte sie nicht benutzen.
Schlussexkurs: Ulbricht, Stalin und die Illusion der Lagerlogik
Wer glaubt, dass „Sozialismus“ ein dogmarisch-monolithisches System war, verkennt die historischen Brüche und inneren Widersprüche. Walter Ulbricht etwa erkannte in den frühen 1960er Jahren, dass das starre Planwirtschaftsmodell der DDR an seine Grenzen stieß. Seine Reformversuche – vorsichtige Marktmechanismen, produktivitätsorientierte Steuerung – führten zu einer kurzen Phase relativer Prosperität. Doch als die Sowjetführung unter Breschnew selbst zu Zugeständnissen bereit war, wurde Ulbrichts wiedergekehrte dogmatische Starrheit zum Problem. Er musste gehen – nicht wegen zu viel Sozialismus, sondern wegen zu wenig Flexibilität.
Stalin, eine Art Urbild des Staatskommunismus, hingegen ließ sich von nichts beeindrucken – weder von ökonomischer Realität noch von ideologischer Kritik. Seine Staatswirtschaft war nicht sozialistisch im Sinne eines fortschreitenden Emanzipationsprozessese, wie von Marx oder ansatzweise noch von Lenin intendiert, sondern schlicht diktatorisch im Sinne von Kontrolle, Angst und Gewalt. Wer ihn einem „Lager“ zuordnen will, muss das Lager der Diktatoren wählen – nicht das der Sozialisten.
Diese historischen Differenzierungen sind unbequem. Aber sie sind notwendig, wenn man politische Begriffe nicht als Kampfbegriffe, sondern als Erkenntnisinstrumente behandeln will.

Bluesmaker
Auch wenn ich mich wiederhole: Vielen Dank für diesen scharfsinnigen Text!