Expression of concern, 01.11.2025: Es gibt zu den Aussagen dieses Beitrages neue, u.U. relativierende Informationen. Ich werde so bald wie möglich ergänzend berichten.
Wie Politik ME/CFS-Betroffene erneut im Stich lässt

(ChatGPT 5)
Es war ein Video, das Hoffnung machte. Dorothee Bär und Nina Warken traten gemeinsam auf, versprachen Aufmerksamkeit, Forschung, Versorgung. Es klang nach Kontinuität – nach einer Fortführung der Linie, die Karl Lauterbach begonnen hatte: ME/CFS endlich als das zu behandeln, was es ist – eine schwere, oft lebenslange Erkrankung, die junge Menschen aus dem Leben reißt und sie in ein System schleudert, das auf ihre Existenz nicht vorbereitet ist.
Heute, nur wenig später, ist von diesen Zusagen nichts mehr übrig. Die Berliner Zeitung bringt es auf den Punkt: Die Forschung wird gekürzt, die Versorgung bleibt prekär, und Friedrich Merz predigt Arbeit, als sei Krankheit eine Frage der Haltung. Was bleibt, ist Bitterkeit – und der Verdacht, dass das Video von Bär und Warken nicht mehr war als ein Baldriantropfen für Schwerstkranke. Eine Beruhigungsgeste, die Vertrauen simuliert, aber keine Struktur verändert.
Noch am 16. Oktober postete Prof. Carmen Scheibenbogen, Deutschlands führende Forscherin zu ME/CFS und Long COVID:
„Vielen Dank, Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, für die Einladung und den konstruktiven Austausch heute. Es freut mich sehr, dass die Verbesserung der Versorgung von ME/CFS- und Long-COVID-Betroffenen weiterhin ein zentrales Thema im BMG ist.“
Man muss sich das vor Augen führen: Während die führende Wissenschaftlerin öffentlich von konstruktivem Austausch mit der Gesundheitsministerin spricht, wird hinter den Kulissen die Forschung gekürzt, die Versorgung nicht ausgebaut, und die politische Rhetorik driftet in Richtung Arbeitsmoral und Bürgergeld. Die Diskrepanz zwischen plakativer Gesprächskultur und struktureller Umsetzung könnte größer kaum sein.
Ich spreche aus Erfahrung, nicht als Betroffener, aber als lange Begleitender. Der Weg durch die Sozialsysteme mit ME/CFS ist kein Pfad der Hilfe, sondern ein Slalom durch Ablehnung, Unverständnis und institutionelle Ignoranz. Wer jung erkrankt, verliert nicht nur Gesundheit, sondern auch die Aussicht auf eine Erwerbsbiografie. Und am Ende steht – nach maximaler Ausschöpfung aller kaum gegebenen Möglichkeiten – die Grundsicherung. Nicht als Schutz, sondern als Endstation. Gerade junge Menschen haben in der Regel noch keinen Anspruch auf eine Erwerbsunfähigkeitsrente – die auch nicht gerade das ist, was man sich als Lebensziel so vorgestellt hat. Wie auch die Berliner Zeitung mit Recht fragt: Nimmt man wirklich sehenden Auges den Verlust abertausender von Erwerbsbiografien in Kauf? Das ist ein gesamtgesellschaftliches und auch volkswirtschaftliches Problem.
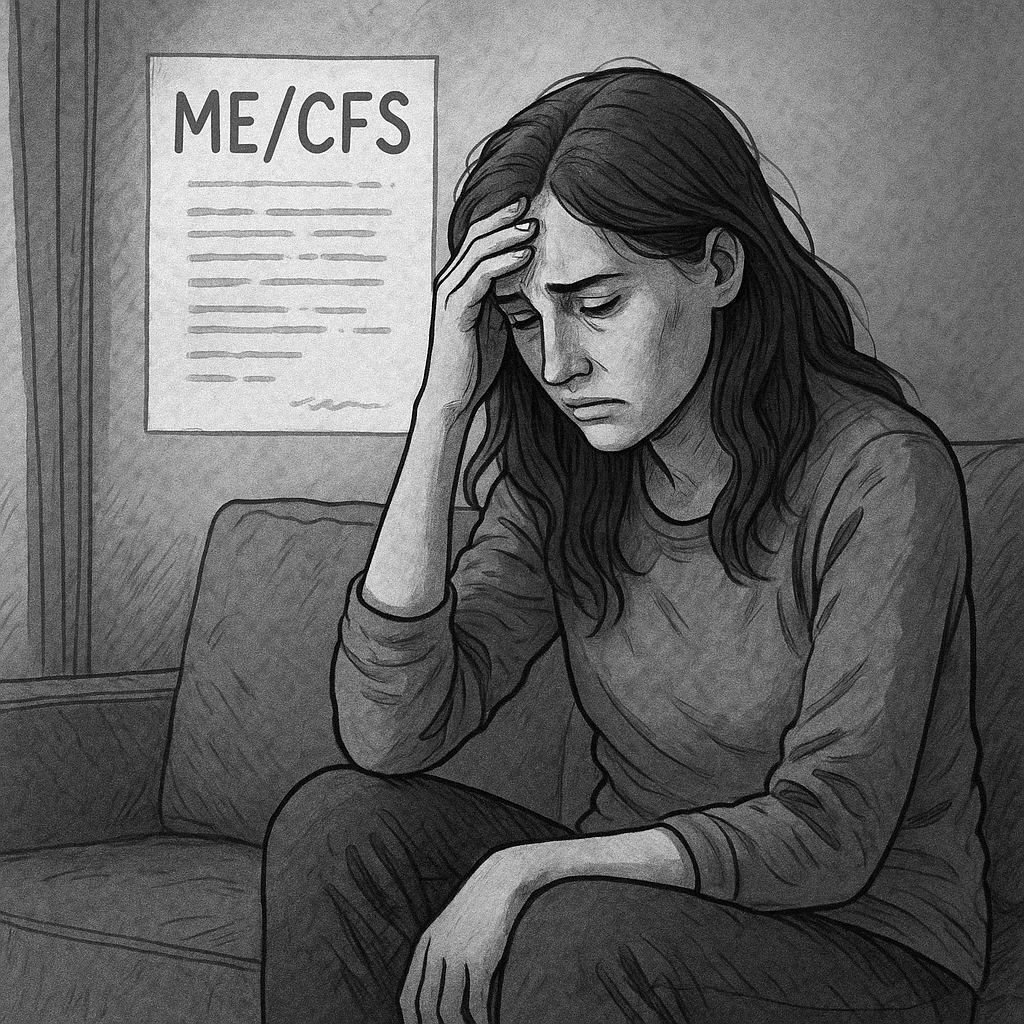
Mich erreichen Stimmen von bislang kämpferisch-optimistischen Betroffenen, die teils über Jahre ihr Schicksal tapfer getragen haben und nun am Rande der endgültigen Resignation stehen. Die Betroffenen haben sich und im Namen der Schwersterkrankten, die selbst nicht mehr aktiv werden können, die Aufmerksamkeit für ME/CFS in Politik und Öffentlichkeit hart erkämpft – und erleben nun, wie Zusagen gebrochen, Hoffnungen enttäuscht und strukturelle Ignoranz fortgeschrieben wird.
Was wir brauchen, ist keine neue Videobotschaft, sondern ein klarer politischer Kurs:
- Forschung, die mit der internationalen Forschergemeinschaft zu ME/CFS auf Augenhöhe kooperieren kann.
- Versorgung, die nicht auf den ungeeigneten Mechanismen des Sozialgesetzbuches basiert, sondern auf realer Lebenslage.
- Sozialsysteme, die nicht bestrafen, sondern auffangen.
Und vor allem: Politiker:innen, die nicht versprechen, was sie nicht halten wollen. Denn wer Hoffnung weckt, trägt Verantwortung – nicht nur rhetorisch, sondern strukturell.
Zum Thema auf diesem Blog;
Immunisierung statt Information – Zur ME/CFS-Stellungnahme der DGN

1 Pingback