Wie Journalismus zur Echokammer politischer Rhetorik wird
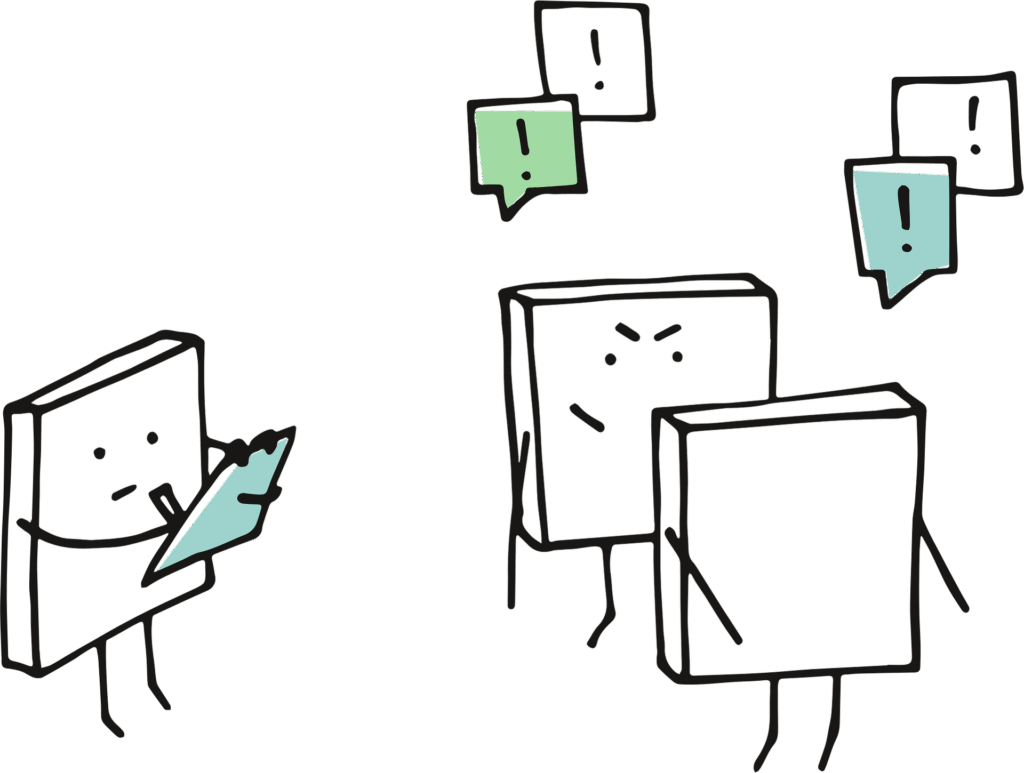
1. Ein Land im rhetorischen Ausnahmezustand
Muss man sich eigentlich jeden Tag aufregen? Manchmal scheint es so. Nicht nur über politische Rhetorik, sondern zunehmend auch über den Journalismus, der sie begleitet – oder besser: der sie verstärkt. Was früher als vierte Gewalt galt, wirkt heute oft wie ein Resonanzkörper für die Inszenierungen der ersten drei.
Ein Beispiel: Der SPIEGEL-Newsletter vom heutigen Morgen. Friedrich Merz hatte zuvor dort für seinen unglücklichen Auftritt in Brüssel Kritik geerntet. Danach geht es um die „Stadtbild“-Äußerungen des Kanzlers und ihre Nachwirkungen. Und was schreibt der SPIEGEL?
„Gemessen an dem Brüsseler Stolperauftritt kommt Merz mit seinem jüngsten innenpolitischen Aufreger noch gut davon. […] Laut ZDF-Politbarometer gaben ihm mehr als 63 Prozent der Befragten recht – jedenfalls, nachdem Merz seine Formulierung konkretisiert und dadurch entschärft hatte.“
Also wieder alles in Butter? Kanzler und Volk einig? Die Empörung verraucht, die Schlagzeilen geglättet, die Regierung segelt weiter – möglichst komfortabel? Lob für den Kanzler, weil er seine Äußerungen „konkretisiert“ und dadurch „entschärft“ habe? Die Straßenproteste und die Empörung in den sozialen Medien – alles linksgrüne Schaumschlägerei nach SPIEGEL-Einschätzung? Weil: Zahlen lügen nicht? Man fragt sich, was da eigentlich geraucht wird in den Redaktionen. Und ob irgendjemand noch auf die Idee kommt, Analyse statt Agitprop zu betreiben.
Denn die 63 Prozent, die Merz angeblich „recht geben“, sind kein Beleg für gesellschaftlichen Konsens – sondern für ein rhetorisches Missverständnis. Oder besser: für eine kommunikative Falle, in die Journalismus und Politik gemeinsam tappen. Oder sie gemeinsam stellen.
2. Die 63 Prozent – ein rhetorischer Trugschluss
„Hat Friedrich Merz Recht?“ So lautete die Frage im ZDF-Politbarometer. Und 63 Prozent der Befragten sagten „Ja“. Das klingt nach Zustimmung, nach gesellschaftlichem Konsens, nach Bestätigung. Und genau das wird medial ausgeschlachtet: „Bevölkerung gibt Merz recht.“ Aber was heißt das eigentlich?
Mirko Lange hat es bei Facebook treffend analysiert: Die Frage ist methodisch und journalistisch unsinnig. Womit soll Merz denn „Recht haben“? Dass es ein Problem mit dem Stadtbild gibt? Dass das an Migranten liegt? Oder dass Abschiebungen helfen? Die Frage impliziert eine überprüfbare Aussage – aber Merz hat keine getroffen. Er hat ein Gefühl formuliert, einen Scheinzusammenhang konstruiert: Stadtbild = Migration = Abschiebung.
Wer darauf „Ja“ sagt, stimmt nicht einer Tatsache zu, sondern einem politischen Framing und reproduziert dahinein seine eigene Interpretation dessen, was der Kanzler wohl gemeint hat. Und das ist der eigentliche Skandal: Das Politbarometer misst nicht die Wirklichkeit, sondern die Wirkung politischer Rhetorik. Es reproduziert den Frame, den es eigentlich prüfen sollte. Und die Medien übernehmen das Ergebnis, als wäre es ein Befund – nicht ein Echo.
So entsteht ein rhetorischer Trugschluss: Aus einem sprachlichen Kunstgriff wird scheinbar gesellschaftlicher Konsens. Aus einem Gefühl wird eine Schlagzeile. Und aus einer Schlagzeile wird politische Legitimation. Das ist kein Journalismus – das ist Kafka mit Tabellen.
3. Die Falle: Wenn Umfragen Rhetorik messen statt Realität
Die Zahlen, die das Politbarometer liefert, sind auf den ersten Blick eindeutig. Doch bei näherem Hinsehen zeigen sie eine tiefe Diskrepanz zwischen Gefühl und Wirklichkeit. Zwei Drittel der Befragten fühlen sich an öffentlichen Orten sicher. Nur 18 Prozent sehen größere Probleme mit Geflüchteten in ihrer Wohngegend. Und dennoch fordern 58 Prozent, es müsse mehr abgeschoben werden. Und 63 Prozent sagen „Merz hat Recht“? Das Unsinnige hierin ist evident.
Was wird hier gemessen? Nicht die Realität, sondern die Resonanz eines rhetorischen Reizes. Sicherheit sinkt nicht, weil Gefahr wächst – sondern weil Angst kommuniziert wird. Die Sprache erzeugt ein Gefühl, das sich dann in Umfragen niederschlägt. Und die Medien greifen dieses Gefühl auf, als wäre es ein Befund.
So entsteht ein gefährlicher Verstärker-Effekt:
- Politiker setzen ein Framing.
- Medien messen die Resonanz dieses Framings.
- Die Schlagzeilen bestätigen es.
- Die Politik nutzt die Schlagzeilen als Beleg für ihre „Volksnähe“.
Ein geschlossener Kreislauf der Selbstbestätigung. Und mittendrin ein Journalismus, der nicht mehr fragt, was ist, sondern was wirkt. Der nicht mehr analysiert, sondern abbildet. Und damit zum Teil des Problems wird, das er eigentlich beleuchten sollte.
4. Das eigentliche Problem: Reduktionismus statt Analyse
Natürlich verändert sich das Stadtbild. Das ist keine Frage. Es verändert sich durch Armut, Leerstand, Drogen, Gentrifizierung – und auch durch Migration. Aber wer dieses komplexe Phänomen ausschließlich mit Abschiebung verknüpft, betreibt keine Analyse, sondern Reduktionismus. Und dieser Reduktionismus ist gefährlich.
Friedrich Merz hat kein Problem benannt, sondern einen Schuldigen. Er hat keine Lösung vorgeschlagen, sondern einen Sündenbock präsentiert. Das ist kein Realismus, sondern eine rhetorische Verschiebung: Weg von Ursachen, hin zu Schuldzuweisungen. Weg von Differenzierung, hin zu Polarisierung.
Und genau hier versagt der Journalismus, wenn er solche Frames übernimmt, statt sie zu prüfen. Wenn er die Wirkung misst, statt die Struktur zu analysieren. Wenn er Empörung als Echo behandelt, statt als Warnsignal. So wird die demokratische Urteilskraft geschwächt – nicht durch Desinformation, sondern durch sprachliche Vereinfachung.
Demokratie braucht Komplexität. Sie braucht Sprache, die erklärt – nicht solche, die entzweit. Und sie braucht Medien, die nicht nur fragen, was die Leute denken, sondern warum sie es denken.
5. Fazit: Demokratie braucht erklärende Sprache – und Journalismus mit Haltung
Die Mehrheit gibt Merz nicht „recht“. Sie reagiert auf einen sprachlichen Reiz, der Unsicherheit in Bedeutung verwandelt. Und wenn Medien das nicht erkennen, werden sie Teil des Problems.
Demokratie lebt von Sprache, die erklärt, nicht von Sprache, die entzweit. Sie braucht Journalismus, der analysiert, nicht nur abbildet. Der fragt, warum Menschen etwas denken, nicht nur was. Und der sich nicht zum Verstärker politischer Rhetorik macht, sondern zum Korrektiv.
Wenn die publizistische Mitte beginnt, Wogen zu glätten, statt sie zu vermessen, wird der Diskurs flach. Und wenn die Empörung über rhetorische Grenzüberschreitungen routiniert in die bedeutungslose Ecke geschoben wird, verliert die Demokratie ihre Sprachsensibilität – und damit ihre Urteilskraft.
Ich erwarte von verantwortlichem Journalismus mehr Haltung. Nicht durch Parteinahme, sondern durch Unterscheidungskraft. Nicht durch Empörung, sondern durch Analyse. Und nicht durch Resonanz, sondern durch Resonanzprüfung.
Postscriptum
Fragen ist so eine Sache. Ich erinnere mich an eine Vorlage, die ich einmal der oberen Etage zugeleitet hatte mit drei Alternativvorschlägen und der Bitte um Entscheidung. Ich bekam den Vorgang zurück – mit einem handschriftlichen „Ja!“ neben den drei Alternativen.
Hier gabs eine Frage, aber keine Antwort. Im Falle des Politbarometers ist es umgekehrt: Es gab gar keine Frage, aber Antworten.
Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich mit Umfragen und Meinungsforschung gelegentlich ein Problem habe?

Andreas Lichte
„Kafka mit Tabellen“ find ich juut !
ist das von Udo Endruscheit, oder ein Fundstück?
„Zwei Drittel der Befragten fühlen sich an öffentlichen Orten sicher.“ Ich nicht.
Wenn ich in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs bin, frag’ ich mich seit neuestem immer:
„Sind die Autofahrer, die dauernd versuchen, mich umzubringen, eigentlich dieselben A****, die AFD wählen?“
–
Inhaltlich stimme ich einmal mehr allem zu.
Frage mich allerdings, wo die Grenzen der Analyse sind: „Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“ gilt heute sicher nicht mehr, hat das überhaupt jemals gegolten?
Meinungsumfragen hielt ich auch vor der Analyse, oben, schon für (potentiell) manipulativ, aber bei der allgemeinen Zustimmung zu „…“ ad lib (Rassismus, Sozialabbau …), fällt mir jetzt immer nur noch Brecht ein:
Hinter der Trommel her
Trotten die Kälber
Das Fell für die Trommel
Liefern sie selber.
Udoessen999
Der Kafka mit Tabellen war ein spontaner Einfall – es sollte erst „Kafka mit Zahlen“ werden. Aber dann fand ich die „Tabellen“ irgendwie schöner.
Allerdings gibt es sogenannte Kafka-Tabellen in der Informationsverarbeitung, das könnte ich aber nicht erklären. Nur eine ganz leichte Ahnung ohne Richtigkeitsgarantie hätte ich dazu. Aber als Assoziationsgrundlage nehme ich das gerne.
Die Grenzen der Analyse? Sie löst kein Problem. Sie weist nur auf anderer Leute Problem hin und ist deshalb, zumal in einem kleinen Blog, eine höchst affirmative Sache ohne Anspruch auf ein causa finita. Eine Melange aus Missmut, Ironie und Besserwisserei …
Andreas Lichte
“ … zumal in einem kleinen Blog, eine höchst affirmative Sache ohne Anspruch auf ein causa finita …“
jetzt mal keine falsche Bescheidenheit – die Artikel, die hier erscheinen, können auch in größerem Zusammenhang bestehen, einen Beitrag zur 11. These über F. liefern