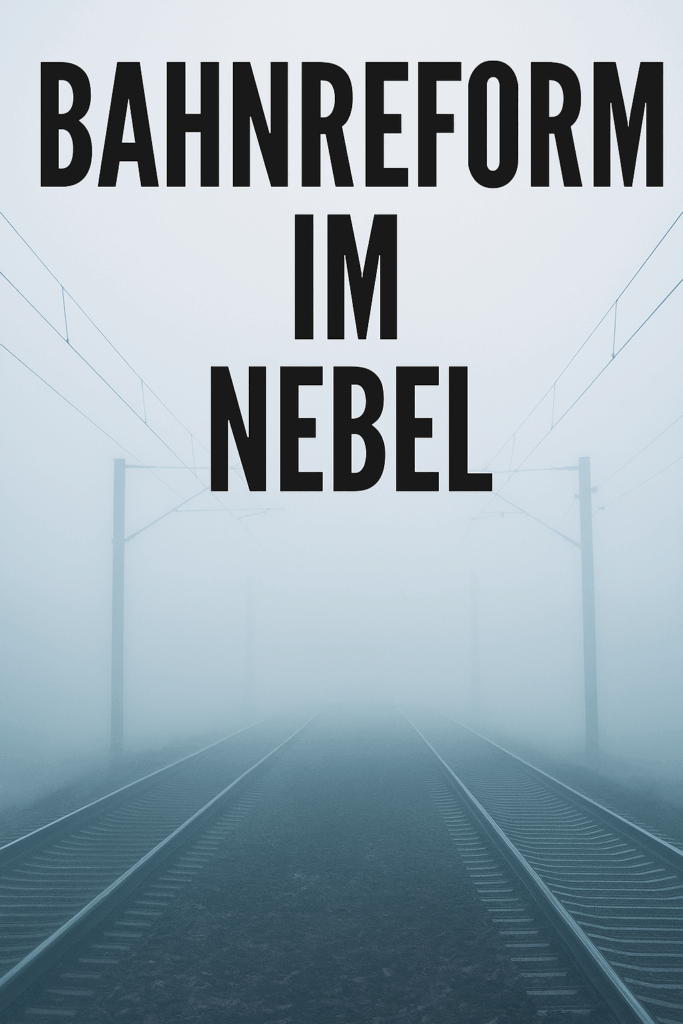
Man muss kein Fachmann für Verkehrspolitik sein, um zwischen den Zeilen des aktuellen SPIEGEL-Artikels über die neue Bahnchefin Evelyn Palla zu lesen: Von der einst groß angekündigten Reform der Deutschen Bahn ist nichts mehr übrig – außer dem Versuch, die Erwartung an sie möglichst geräuschlos herunterzudimmen.
Vom Aufbruch zur Abarbeitung
Ursprünglich sollte das 32-seitige Strategiepapier von Minister Schnieders die Bahn neu denken – als Aufbruchsdokument, das das Verhältnis zwischen Bahn, Bund und Regulierungsbehörde endlich klärt und die dysfunktionalen Doppelstrukturen zwischen Netz, Betrieb und Konzernführung aufbricht.
Davon ist in der SPIEGEL-Darstellung nichts geblieben. Das Papier wird zu einer To-do-Liste für Frau Palla herabgestuft.
Von einer „Neuaufstellung“, von Governance-Fragen oder einer politischen Neujustierung des Konzernverhältnisses – keine Spur.
Der Artikel feiert Personalentscheidungen und „handwerkliche Verbesserungen“, als sei damit der große Wurf bereits getan.
So wird aus dem Anspruch auf Reform die Verwaltung des Dauerproblems.
Die Normalisierung des Stillstands
Der Tenor des Beitrags erinnert frappierend an PR-Prosa:
Evelyn Palla als entschlossene Macherin, die den Laden unter „Einsturzgefahr“ umbaut, die anpackt, strukturiert, handelt.
Doch die eigentlichen Fragen, die seit Jahren ungelöst sind, werden gar nicht gestellt:
- Wie kann ein Konzern reformiert werden, dessen Eigentümer (der Bund) zugleich Regulator und politischer Auftraggeber ist?
- Wie will man Effizienz erreichen, solange der politische Zugriff auf operative Entscheidungen bestehen bleibt?
- Wie soll die Bahn als Unternehmen funktionieren, wenn sie gleichzeitig Infrastrukturträger, Verkehrsdienstleister und politisches Symbol ist?
Keines dieser Themen taucht auf. Stattdessen wird der Stillstand als Normalität beschrieben – als handwerkliches Problem, nicht als systemisches Versagen.
Reform im Nebel
Man gewinnt den Eindruck, dass die Idee einer echten Bahnreform – der Trennung von Netz und Betrieb, der Befreiung von politischer Tagessteuerung, der klaren Definition von Zuständigkeiten – längst vom Tisch ist. Übrig bleibt das Ritual des Aufbruchs: neue Führung, neue Worte, dieselben Strukturen.
Die Entlassung der DB-Cargo-Chefin wird als Managementleistung verkauft, obwohl ihr Abgang schon zu Zeiten von Richard Lutz längst absehbar war. Das alles wirkt nicht wie Neuanfang, sondern wie das Wiederaufwärmen eines längst erkalteten Gerichts.
Wer den Artikel liest, versteht: Der SPIEGEL hat das Vertrauen in den „großen Wurf“ offenbar selbst verloren – und tut so, als wäre das kluge Nüchternheit. In Wahrheit ist es Resignation im Ton der Anerkennung.
Das wiederkehrende Muster
Es ist das alte Muster der deutschen Infrastrukturpolitik: Man erkennt die Komplexität, nennt sie „Herausforderung“, verschiebt sie – und nennt das dann Fortschritt.
So, wie man es mit der Energiewende tat.
So, wie man es mit der Digitalisierung tat.
Und so, wie man es nun wieder mit der Bahn tut.
Der Artikel über Evelyn Palla erzählt nichts Neues über die Bahn – aber sehr viel über die Erschöpfung des politischen und medialen Willens, ihre Struktur wirklich zu verändern. Die nächste gescheiterte Reform kündigt sich nicht an. Sie findet bereits statt.

Schreibe einen Kommentar