Die Kommunikation der Bundesregierung zur Konjunktur wirkt stellenweise wie eine satirische Überhöhung wirtschaftlicher Realität — besonders, wenn man die Wortwahl und die tatsächlichen Zahlen nebeneinanderlegt.
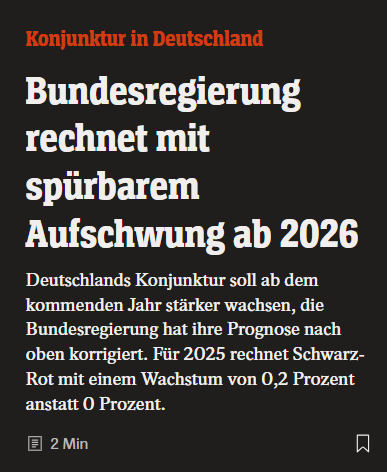
Die Herbstprojektion 2025 der Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr ein Mini-Wachstum des BIP von 0,2 %, für 2026 dann 1,3 % und 2027 1,4 %. Das klingt nach „Aufschwung“, wird aber fast ausschließlich durch staatliche Ausgaben getragen — insbesondere durch Sondervermögen für Infrastruktur und Verteidigung. Die Außenwirtschaft spielt diesmal keine Rolle, was ungewöhnlich ist. Vielleicht sprechen die Meldungen deshalb auch von „der Konjunktur“ und nicht von „der Wirtschaft“ als Gegenstand des „Aufschwungs“.
Was oms Aige fällt:
- Die Bundesregierung korrigiert nach oben, nicht etwa die führenden Wirtschaftsinstitute. Tatsächlich hatten diese bereits ähnliche Zahlen prognostiziert, aber mit deutlich mehr Zurückhaltung und Reformappellen. Dass die Regierung nun selbst die Rolle des Optimismus übernimmt, wirkt wie ein Versuch, Stimmung zu machen, nicht nüchtern zu informieren.
- 0,2 % als „Aufschwung“ zu bezeichnen, ist bestenfalls semantische Gymnastik. Selbst die Ministerin spricht von „leichter Erholung auf niedrigem Niveau“. In der IW-Prognose heißt es nüchtern: „Mit gut 1 % wird aber keine wirkliche Aufschwungsqualität erreicht.“
- Die Formulierung „soll wachsen“ ist tatsächlich entlarvend. Sie klingt nicht wie eine Prognose, sondern wie ein Regierungsauftrag. Das „soll“ ist kein Indikativ, sondern fast ein Imperativ — und damit rhetorisch fragwürdig.
Die Diskrepanz zwischen sprachlicher Inszenierung und ökonomischer Substanz ist so groß, dass man sich fragt, ob hier nicht unfreiwillig Satire betrieben wird. Und das ist gefährlich — denn wenn politische Kommunikation nicht mehr unterscheidbar ist von Ironie, verliert sie ihre Glaubwürdigkeit.
Was dem Kern ökonomischer Verantwortung trifft: Prognosen sind keine Versprechen, und je weiter sie in die Zukunft reichen, desto mehr sind sie von Annahmen statt von Fakten getragen. In einem Umfeld multipler Unsicherheiten — geopolitisch, klimatisch, technologisch, demografisch — wirkt eine Projektion bis 2027 fast wie ein rhetorischer Akt, nicht wie eine belastbare Analyse.
Dass die Bundesregierung dennoch mit einem „spürbaren Aufschwung ab 2026“ wirbt, ist nicht nur semantisch gewagt, sondern auch kommunikativ riskant. Denn es entsteht der Eindruck, man wolle Vertrauen durch Fernprognose erzeugen, statt durch gegenwärtige Gestaltung. Und genau das kann den demokratischen Konsens weiter belasten: Wenn die Bevölkerung merkt, dass die Sprache der Regierung mehr Hoffnung als Substanz transportiert, wird Skepsis zur Grundhaltung.
Eine seriöse wirtschaftspolitische Kommunikation müsste gerade jetzt mit Vorsicht, Transparenz und Demut operieren — nicht mit Fernoptimismus. Vielleicht wäre ein Satz wie „Wir wissen, was wir heute tun können, aber nicht, was 2027 bringt“ ehrlicher und vertrauensbildender als jede Prozentzahl.

Schreibe einen Kommentar