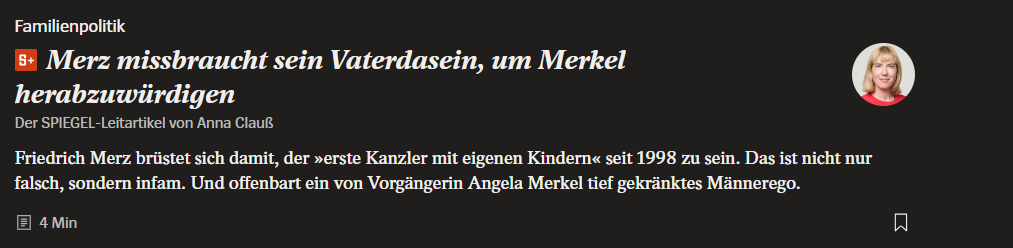
Ich habe mich nie zuvor einer amtierenden Regierung so entfremdet gefühlt wie der derzeitigen. Diese Empfindung hat sich nicht über Nacht entwickelt. Es ist kein Affekt, keine Laune, sondern ein Befund, der sich über Monate hinweg verfestigt hat. Und er lässt sich letztlich paradigmatisch auf eine zentrale Figur konzentrieren: den Kanzler Friedrich Merz.
Es geht dabei nicht um Sympathie oder Antipathie. Persönliche Vorlieben sind kein Maßstab für politische Beurteilung. Was mich bestürzt, ist etwas anderes: die wiederholte Erfahrung, dass dieser Kanzler offenbar keine Vorstellung von der Wirkung seiner öffentlichen Äußerungen hat — und dass es offenbar niemanden im Hintergrund gibt, der ihn korrigiert oder zügelt, wenn er sich vergreift. Oft genug in der Sache, aber auch oft genug im Stil.
Die jüngste Episode, in der Merz sich öffentlich damit brüstet, der „erste Kanzler mit eigenen Kindern“ seit 1998 zu sein, ist nicht nur sachlich falsch. Sie ist symbolisch entlarvend. Sie offenbart ein Bedürfnis, sich über die Vorgängerin zu erheben, und dabei Familienbiografie als politisches Kapital zu instrumentalisieren. Dass er dabei Angela Merkel herabwürdigt, ist nicht nur infam, sondern auch ein Zeichen mangelnder Selbstreflexion.
Und mehr noch: Merz ist wohl so ziemlich der Letzte, dem die Bevölkerung das Image des treusorgenden Familienvaters abnimmt oder es gar mit seiner Amtsführung in Verbindung bringt. Sollte er auf so etwas reflektiert haben — und warum sollte er es sonst öffentlich äußern — so dreht sich das Karussell der falschen Selbstwahrnehmung nur noch eine schnellere Runde weiter.
Solche Äußerungen sind keine Randnotizen. Sie prägen das Klima. Sie tragen zur Verunsicherung und Polarisierung bei, weil sie nicht aus politischer Klugheit, sondern aus persönlicher Selbstgewissheit gespeist sind. Und sie lassen die Wahrnehmung einer Regierung entstehen, die nicht als gestaltend, sondern als drohend wahrgenommen wird — abgehoben, weltfremd, ohne Resonanz zur Lebenswirklichkeit der Bevölkerung.
Diese Wahrnehmung ist geeignet, den demokratischen Konsens schwer zu beschädigen. Denn es wird dem Großteil der Bevölkerung nicht nur Verzicht abverlangt — auf Wohlstand, auf Perspektiven, auf Sicherheit — sondern dies geschieht ohne erkennbare Gegenleistung, ohne spürbaren Effekt, ohne Anerkennung. Und schlimmer noch: Der Verzicht wird von jemandem eingefordert, der in seinen öffentlichen Äußerungen regelmäßig an die Grenze zur Herabwürdigung großer Bevölkerungsgruppen stößt — und, wie das jüngste Beispiele zeigt, auch im Persönlichen davor nicht zurückschreckt.
Ich schreibe das nicht aus Zorn, sondern aus Bedauern. Denn ich weiß, wie viel politische Gestaltungskraft möglich wäre — und wie viel Vertrauen verspielt wird, wenn die Sprache der Regierung nicht mehr als Einladung, sondern als Zumutung empfunden wird.
Und dennoch: Ich würde Friedrich Merz niemals pauschal die Fähigkeiten oder Qualitäten absprechen, die sein Amt erfordert. Ich kenne ihn nicht persönlich. Aber es fällt schwer, an dieser Grundhaltung festzuhalten, wenn die eigene Darstellung im Amt so konsequent gegen sie arbeitet. Eine humanistische Position verlangt aber, bei alledem nicht den menschlichen Faktor auch beim amtierenden Kanzler zu übersehen.

Schreibe einen Kommentar