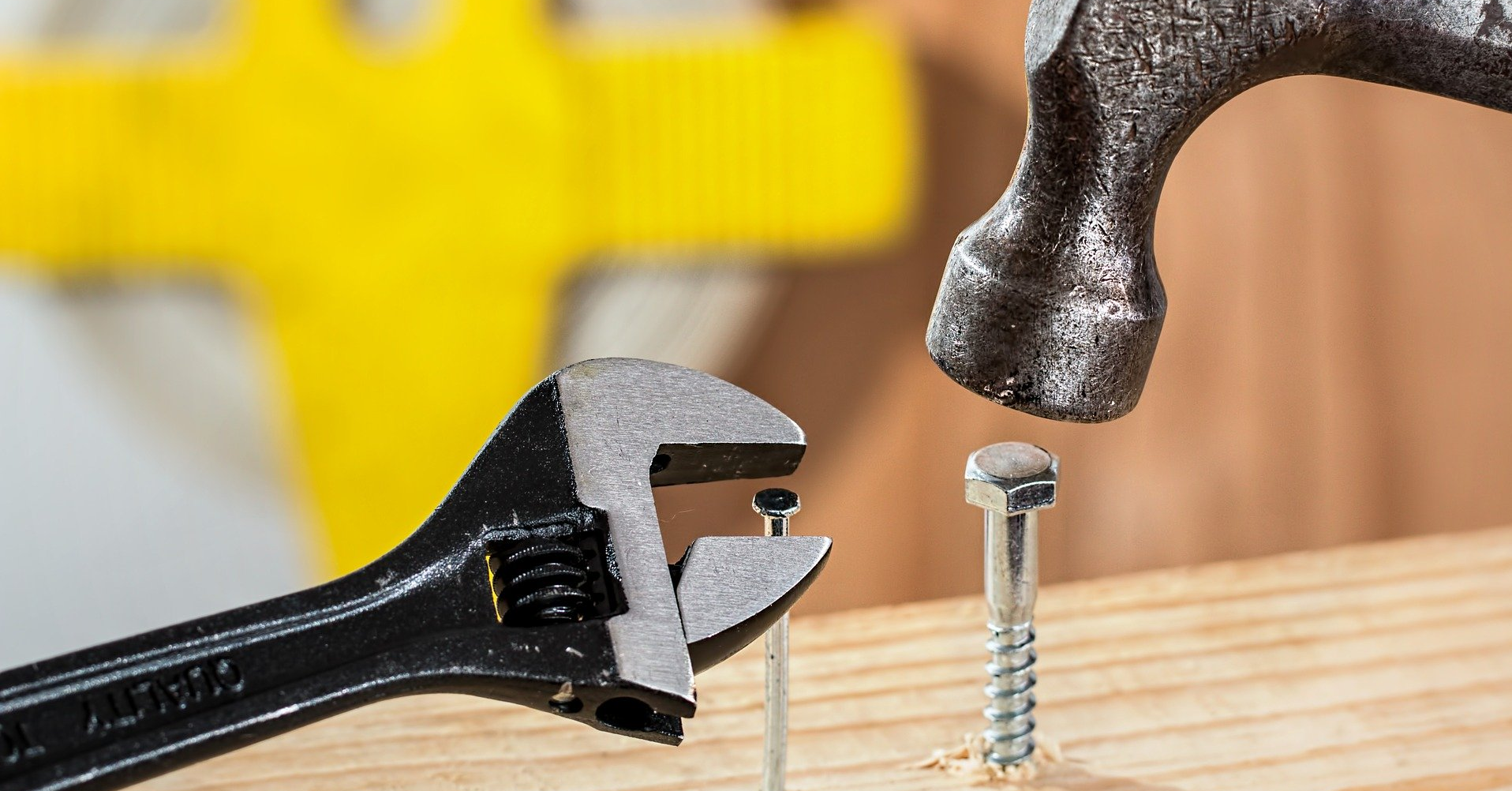
Die Securvita, eine „alternativen“ Methoden eher zugeneigte GKV-Kasse, echauffiert sich in einer Veröffentlichung [1] namens „Karriere einer Falschmeldung: Wie eine fehlerhaft interpretierte Studie der Charitè von Gegnern der Homöopathie in Politik und Medien missbraucht wird“ über – ja über was eigentlich? Darüber, dass „Homöopathie-Gegner hier – aus Absicht oder Unkenntnis – offensichtlich ein Problem mit der wissenschaftlich sauberen Faktenlage [haben].“ Was Wunder, dass dies von einschlägigen homöopathischen Verbänden, voran die Stiftung Natur und Medizin, u.a. in den Sozialen Medien aufgegriffen wird.
Naja. Was sind hier „Homöopathie-Gegner“? Etwas pauschal, finde ich. Rekurriert wird auf Papiere aus dem politischen Raum. Jedenfalls kann doch wohl nicht mit den „Homöopathie-Gegnern“ die wissenschaftlich orientierte Homöopathiekritik gemeint sein kann, wie sie vom Informationsnetzwerk Homöopathie vertreten wird. Denn diese hat niemals den von der Securvita einigermaßen vehement beanstandeten (durchaus nicht zutreffenden) Schluss aus der „Studie der Charité“ gezogen, Homöopathie sei „teurer“ oder „zu teuer“ und sie müsse deshalb aus dem Leistungskatalog der GKV eliminiert werden. Natürlich handelt es sich bei der „Studie der Charité“ um die vielzitierten Arbeiten von Ostermann J, Witt C et al. aus den Jahren 2015 und 2017, die aufgrund von Daten der Techniker Krankenkasse die Kostenverläufe homöopathieaffiner und nicht homöopathieaffiner Patientengruppen verglichen. [2] [3]
Dass die von der Securvita beanstandete Schlussfolgerung aus diesen Arbeiten nicht zum Argumentationsrepertoire des INH gehört, lässt sich leicht belegen.
Beispielsweise mit einem Schreiben des INH an die Techniker Krankenkasse, in dem es heißt:
„… sondern suchen vielmehr, Ihre Ertragsposition durch das Einwerben „günstiger Risiken“ zu verbessern. Was sich, wenn man einer entsprechenden Untersuchung unter Ihren Mitgliedern glaubt, als Trugschluss erwiesen hat“.
Worauf wird abgehoben? Auf „Homöopathie ist zu teuer?“ Ersichtlich nicht, sondern auf eine Einschätzung der unternehmerischen Gesamtprognose des „Einwerbens“ gut zahlender und gleichzeitig „gesundheitsbewusster“ Mitglieder, auf die “Ertragsposition”.
Ein Informationsbeitrag des INH zu den Ostermann-Witt-Studien [4] führt – unter dem im Grunde schon abschließend klarstellenden Titel „Nichts ist immer zu teuer“ – in gleichem Tenor aus:
„Die homöopathieaffine Gruppe, die Hälfte der Gesamtstudienteilnehmer, verursachte also über 18 Monate rund 1.350 Euro pro Kopf Mehrkosten gegenüber den Patienten der Gruppe ohne Inanspruchnahme von Homöopathie.“
„Natürlich sind mögliche Ursachen hierfür über eine gewisse Bandbreite hinweg denkbar. Es ist aber zu berücksichtigen, dass durchweg die Krankenkassen mit ihren Satzungsleistungen eine jüngere, gesündere Klientel ansprechen wollen und sich natürlich von dieser Gruppe auch durchweg niedrigere Aufwendungen versprechen. Dies scheint offensichtlich nicht zu funktionieren.“
Wo steht hier oder ist herauszulesen, dass Homöopathie „teurer“ oder „zu teuer“ sei und deshalb zu streichen sei?
Weiter geht es in aller Deutlichkeit mit einem Schreiben des INH an die Siemens BKK vom 8. Januar 2018 [5], als Antwort darauf, dass deren Vorstandsvorsitzender seinerseits die Erstattungsdiskussion mit dem „Peanuts“-Argument beenden wollte:
„Es sollte genügen, darauf zu verweisen, dass die Herausnahme der Homöopathie aus dem britischen öffentlichen Gesundheitssystem mit dem ausdrücklichen Statement des NHS (National Health Service) verbunden war, es gehe -nicht einmal nachrangig- um eine Kostenersparnis, sondern vielmehr um „fehlende klinische Wirksamkeit“ und die daraus folgende „geringe Kosteneffektivität“, also um das nicht vorhandene Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Denn: Nichts ist immer zu teuer. Aus den Stellungnahmen der übrigen staatlichen Stellen, die im Jahre 2017 die Homöopathie aus ihren Gesundheitssystemen entfernt haben (Australien und Russland) ist uns auch nicht bekannt, dass die Kosten eine Rolle, geschweige denn eine entscheidende, gespielt haben, ebensowenig wie beim oben zitierten Statement des Wissenschaftlichen Beirats der Europäischen Wissenschaftsakademien (EASAC). […]
Jeder Euro an Beitragsgeldern verlangt unter dem Aspekt der Redlichkeit gegenüber den Mitgliedern Sorgfalt bei der Verwendung. … Aber dies betrifft nicht unser Kernanliegen.“
Auch der Offene Brief des INH an Minister Spahn zu seinem Homöopathie-Statement vom September 2019 [6] behandelt den Kostenaspekt nur als einen von vielen Punkten – mit der – die bisherige Position nur nochmals bestätigenden – Aussage:
„Nach den Untersuchungen von Witt/Ostermann verursachen homöopathieaffine Patienten bei der Krankenversicherung durchweg höhere Kosten.“
Homöopathie „zu teuer“? Kein Wort.
Unmissverständlicher kann die Position der Homöopathiekritik kaum dargestellt werden. Nichts davon scheint die Securvita zur Kenntnis genommen zu haben, wenn sie sich darin gefällt, pauschal „den Homöopathiegegnern“ zu unterstellen, diese argumentierten mit einem „zu teuer“ und fehlinterpretierten damit Ostermann/Witt et al. .
Der Kostenaspekt, wie auch immer betrachtet, spielt für die Homöopathiekritik bei der Frage, ob man einer ohnehin schon fehlinformierten Patientenschaft eine Methode wie die Homöopathie auch noch als erstattungsfähig seitens der gesetzlichen Krankenkassen präsentieren soll, ersichtlich kaum eine Rolle. Die Befassung der Homöopathiekritik mit diesem Aspekt wurde durch die damals beteiligten GKV-Kassen selbst ausgelöst, die ihrerseits – wie Minister Spahn heute – mit dem Scheinargument der marginalen Kosten auftraten, um die Debatte zu beenden. Zu keinem Zeitpunkt wurde aufgrund der Ostermann-Witt-Studien von der wissenschaftlichen Homöopathiekritik die Schlussfolgerung gezogen, Homöopathie habe deshalb keinen Platz in der GKV, weil sie „zu teuer“ sei.
Und – die Securvita mag es wahrscheinlich kaum glauben – die Kritiker wissen sehr wohl, dass die Mehrkosten laut Studie nicht durch Kosten “für Homöopathie” ausgelöst wurden – das kann man nämlich in den Arbeiten nachlesen. Sie sind vielmehr auf überdurchschnittliche Kosten infolge von Krankschreibungen zurückzuführen. Was die Grundannahme der „Werbung“ mit Homöopathie bei den Kassen, man werbe junge, gesunde und gutverdienende Mitglieder ein, zumindest in einem Aspekt mit einem Fragezeichen versieht.
Die Kassen gehen davon aus, dass selbst bei Inanspruchnahme von Homöopathie und damit entstehenden Mehrkosten die gesundheitsbewusste und eben homöopathieaffine Klientel, die zudem mit “gutsituiert” assoziiert wird, Beiträge zahlt, die sich an der Obergrenze der Beitragsbemessungsgrenze orientieren. Hiervon erwartet man offenbar insgesamt einen Positivsaldo auf der Einnahmeseite (“Verbesserung der Ertragssituation”). Zum einen ist dies eine auf längere Zeiträume gerichtete Spekulation, die weder belegt noch widerlegt ist – auch nicht durch das Ostermann-Witt-Papier und erst recht nicht durch die Ausführungen der Securvita. Die Spekulation richtet sich offenbar darauf, dass das Gesundheitsbewusstsein dieser Gruppe sich auch darin niederschlagen wird, dass sie insgesamt (evtl. trotz zusätzlicher Homöopathie) jedenfalls nicht wesentlich mehr GKV-Leistungen als der Durchschnitt der Versicherten in Anspruch nehmen werde. Wenn Ostermann-Witt einen Schluss nahelegen, dann den, dass eine solche Spekulation sehr gewagt ist und es Variablen in der Gleichung gibt, die man am Anfang nicht bedacht hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Als letzter Beleg dafür, dass das Statement der Securvita an der Position der Homöopathiekritik vorbeigeht, soll der Beitrag von Dr. Natalie Grams und Dr. Christian Lübbers „Warum Homöopathie keine Leistung der solidarisch finanzierten Krankenkassen sein sollte“ [7] angeführt werden. Diese Arbeit begründet umfangreich aus medizinwissenschaftlicher und gesundheitspolitischer Sicht, dass und warum die Erstattung von Homöopathie durch gesetzliche Krankenkassen eine unvertretbare Fehlleistung ist, die die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung schwächt, das Vertrauen in die wissenschaftsbasierte Medizin untergräbt und mit der Aufgabe der Krankenkassen unvereinbar ist, eben diese Gesundheitskompetenz der Patientenschaft zu stärken. Der Kostenaspekt findet sich lediglich am Rande in den Schlussbemerkungen, und zwar mit einem Tenor, der wiederum das glatte Gegenteil dessen darstellt, was die Securvita bei den „Homöopathiegegnern“ konstatieren will.
Die Krankenkassen gehen davon aus, ihnen werde ein ökonomischer Vorteil zuwachsen, wenn es ihnen gelingt, mit dem Angebot von Homöopathieerstattungen eine junge, möglichst gesunde und zudem gesundheitsbewusste Klientel zu binden. Das mag immerhin noch ein rationaler Ansatz sein, der allerdings eher zu einem Handelsunternehmen als zu einer Krankenkasse eines Solidarsystems passen dürfte. Jedoch ist längst mit hinreichender Sicherheit klar, dass diese Rechnung letztlich nicht aufgeht. Nach fundierten Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse verursachen Homöopathie-Patient*innen bei der GKV durchweg höhere Kosten als eine nicht auf Homöopathie setzende Vergleichsgruppe.
Auch hier wird nicht auf „Homöopathie ist teurer / zu teuer“, sondern genau auf die Einschätzung abgehoben, „unter dem Strich“ würde eine so agierende Kasse einen „Wettbewerbsvorteil“ erlangen – und zudem auf das Deplatzierte einer solchen Überlegung bei einer Kasse des solidarischen GKV-Systems hingewiesen. Das Fazit der Arbeit verdeutlicht dies in aller Klarheit:
Das deutsche öffentliche Gesundheitssystem ist kein Markt. Es wurde als Solidarsystem konzipiert, das alle nach ihrer Leistungsfähigkeit be- und nach ihrer Bedürftigkeit entlastet. Es ist eine falsche und abwegige Vorstellung, Homöopathie als eine Methode ohne jeglichen validen Wirkungsnachweis aus diesem System heraus zu finanzieren, etwa weil ein Teil der Versicherten es so wünscht und Krankenkassen sich davon Wettbewerbsvorteile erhoffen. Der im Gesamtrahmen geringe Betrag für Homöopathie spielt angesichts der anderen beherrschenden Aspekte keine entscheidungsrelevante Rolle.
Die gesetzliche Krankenversicherung ist nicht für das Prinzip eines Wettbewerbs zwischen den Leistungsträgern gedacht. Der Fokus auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des öffentlichen Gesundheitswesens verstellt allzu oft den Blick darauf, dass Patientenwohl und Patientenschutz die primären Ziele sind. Diese Aspekte zugunsten einer reinem Wettbewerbsdenken geschuldeten Maßnahme hintenan zu stellen, die zudem nicht einmal ökonomisch sinnvoll scheint, (Anm. UE: das heißt nicht „zu teuer“) kann nicht Gegenstand nachhaltiger Gesundheitspolitik sein. Solche Schräglagen, bedingt durch Denken in Kategorien wie Kommerz, Privatisierung, Gewinnmaximierung oder auch Wettbewerb (Maibach-Nagel 2019) gefährden das System im Kern, beeinträchtigen die Gesundheit und kosten im schlimmsten Fall Menschenleben.”
Offenbar gerät tatsächlich in manchen Chefetagen von GKV-Kassen in Vergessenheit, dass man – bei aller Eigenständigkeit – Teil eines gemeinsamen Solidarsystems ist. Einst verlautbarte im Rahmen der Homöopathiedebatte die Chefin einer nicht ganz kleinen Kasse, wenn die Versicherten es wünschten, würde sie auch eine Schokolade pro Tag bezahlen Leider kein Scherz – sondern eine Selbstvergessenheit sondergleichen..
Anderen Kassen durch gezieltes Anwerben gutverdienender Klientel mittels Leistungen, die aus einer Reihe von Sachgründen nicht in ein Solidarsystem gehören, das Wasser abzugraben, kann ohnehin eigentlich nur als eine Form der Kannibalisierung des Systems betrachtet werden. Lässt der Gesetzgeber so etwas zu, betritt er schwankendes Terrain und sollte sich deshalb vor der Falle massiver Fehlanreize hüten – ich überlasse es dem Leser, zu beurteilen, ob dies beim Satzungsleistungskatalog 2012 (3. GKV-Versorgungsstrukturgesetz) wohl der Fall war. Hinzu kommt, dass bei der Vielzahl der Kassen, die Homöopathie als ein solches „Werbemittel“ einsetzen, sich jeder Effekt eines „Wettbewerbsvorteils“ längst totgelaufen haben dürfte. Und – nicht zu vergessen – der Beitragspool der Kassen über den Risikostrukturausgleich ohnehin wieder teilweise nivelliert wird.
Man kann mit guten Gründen Verständnis dafür haben, dass die Politik den Weg zu einer Einheitskasse nicht in Erwägung zieht, wenn auch angesichts des grundsätzlich gleichen Leistungsspektrums Unterschiede (der “Wettbewerb”) nur über künstliche Eingriffe (wie das Spektrum der Satzungsleistungen) erreicht werden können. Andere Modelle sind denkbar, z.B: wie in England (NHS) oder in Österreich (Allgemeine Versicherung), wo das System zentral gesteuert wird, aber Regionalorganisationen innerhalb eines fixen Rahmens durchaus flexibel agieren können. Als Wettbewerbsmittel aber unwirksame, der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung abträgliche Mittel und Methoden zuzulassen, geht zu weit. Prof. Dr. Tina Salomon, Gesundheitsökonomin aus Bremen, schreibt beim INH dazu:
„Das Leistungsniveau in Deutschland ist sehr hoch, trotzdem gibt es aber zwischen den Regelleistungen auf der einen Seite und den nachgewiesen unwirksamen Maßnahmen auf der anderen eine Zone, in der mit Satzungsleistungen und Wahltarifen noch Gesundheits- und Lebensqualitätszugewinne zu realisieren sind und die deshalb für die Differenzierung der Krankenkassen sehr viel besser geeignet sind als die Homöopathie. In diese Zone fallen viele verhaltenspräventive Maßnahmen und damit auch der immer stärker werdende Bereich Digital Health.“ [8]
Es gibt demnach keinen Grund, sich als Vertreter der wissenschaftlich orientierten Homöopathiekritiker von der Securvita angesprochen zu fühlen. Gleichwohl – hony soit qui mal y pense, will sagen: Was bezweckt die Securvita mit diesem Rundumschlag, der sehr auffällig ein Detail der Debatte zum Inhalt massiver Bezichtigungen “der Homöopathiegegner” hochspielt? Worum handelt es sich eigentlich bei der Eloge der Securvita, der ja inhaltlich die Berechtigung nicht gänzlich abgesprochen werden kann, insofern, als ja wirklich Ostermann-Witt et al. keine “teurere Homöopathie” belegen und das offensichtlich auch nicht Ziel der beiden Arbeiten war? Ist es ein Versuch, von den wissenschaftlichen, gesundheitspolitischen und medizinethischen Kernpunkten der fundierten Homöopathiekritik abzulenken? Oder ein Versuch, „die Homöopathiegegner“ pauschal in ein schlechtes Licht zu rücken?
Ich weiß es nicht. Eine wirkliche Befassung mit den Positionen und Argumenten der wissenschaftlich fundierten Homöopathiekritik wäre der Securvita anzuraten. Dann würde man möglicherweise nicht – aus Absicht oder Unkenntnis – zu einem pauschalen Rundumschlag gegen „die Homöopathiegegner“ ausholen, wenn man glaubt, zur Debatte beitragen zu müssen. Bei der Gelegenheit könnte man sich auch gleich einmal mit der “wissenschaftlich sauberen Faktenlage” zur Wirksamkeit der Homöopathie befassen. Dann wären auch Hinweise auf das anthroposophische “Gutachten” für die Beratung bei Bündnis 90/Die Grünen obsolet, von dem die Securvita meint, es in einem Infokasten auch noch besonders herausstellen zu müssen. [9]
[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26230412
[3] http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0182897
[4] https://netzwerk-homoeopathie.info/zur-neuen-homoeopathie-kostenstudie-nichts-ist-immer-zu-teuer/
[7] WISO direkt ; 2019,19), Electronic ed.: Bonn: FES, 2019, ISBN 978-3-96250-422-9 – http://library.fes.de/pdf-files/wiso/15715.pdf
Bild von Steve Buissinne auf Pixabay

Schreibe einen Kommentar