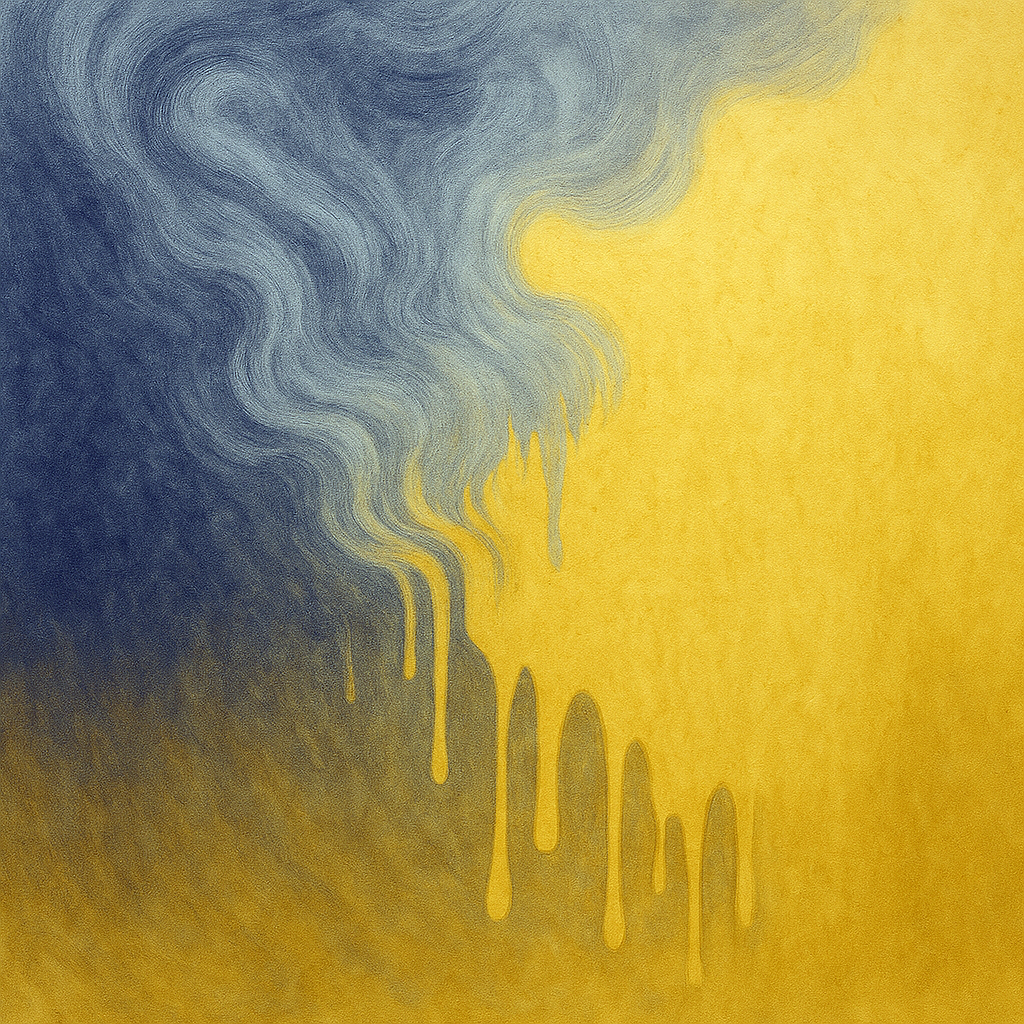
Wer sich das Etikett des Skeptikers zu eigen macht, verpflichtet sich – so sollte man meinen – zu intellektueller Redlichkeit, methodischer Strenge und erkenntnisoffener Kritik. Doch was, wenn aus Skepsis eine Rhetorik des Nichtwissens wird? Wenn der Zweifel nicht mehr fragt, sondern nur noch zersetzt? Wenn jede Hoffnung als Naivität erscheint – und jeder Forschungsansatz als übergriffig?
Die anonyme Reihe auf dem Psiram-Blog zum Thema ME/CFS, mittlerweile vier Artikel lang (hier der vierte Teil, der den Anstoß zu diesem Kommentar gab), zeigt exemplarisch, wie sich skeptischer Anspruch in erkenntnistheoretischen Nihilismus verkehren kann. Die Texte sind sprachlich versiert, bemüht analytisch – und doch durchzieht sie ein Grundton distanzierter Überlegenheitsattitüde, der an keiner Stelle fragt: Was wäre, wenn hier tatsächlich etwas in Bewegung gerät? Was wäre, wenn ernsthafte Forschung endlich möglich wird, nach vier Jahrzehnten strukturellen Desinteresses?
Stattdessen: Alles wird kleingeredet. Wir wissen nichts. Wir haben nichts. Wir dürfen nichts hoffen. Eine Misstrauensästhetik, verkleidet als Wissenschaftskritik. Der Psiram-Autor präsentiert sich als wohlmeinend abgeklärt – doch unter der Oberfläche wirkt sein Text wie ein intellektuelles Nein-Sagen – elegant formuliert, aber letztlich ohne Perspektive.
Was in dieser Serie völlig ausgeblendet bleibt: Dass es sich bei ME/CFS um eine Erkrankung handelt, die über Jahrzehnte marginalisiert, missverstanden und psychologisiert wurde. Dass das jetzige Forschungsinteresse nicht Ausdruck einer Mode ist, sondern einer überfälligen Korrektur. Dass viele der wissenschaftlichen Sackgassen, die der Autor betont, eben deshalb entstanden sind, weil man sich zuvor weigerte, systematisch und unvoreingenommen zu forschen.
Das ist bedauerlich. Denn ME/CFS ist nicht nur ein medizinisches Thema, sondern auch ein Prüfstein für den Zustand unserer wissenschaftlichen Kultur: Wie gehen wir mit Unsicherheit um? Mit Betroffenen, die lange ignoriert wurden? Mit Forschung, die tastet statt triumphiert? Wer hier reflexhaft abwinkt, entzieht sich einer moralischen wie erkenntnistheoretischen Herausforderung.
ME/CFS betrifft Millionen weltweit, hunderttausende hierzulande – viele davon leben seit Jahren in einem Zustand körperlicher und materieller Not, gesellschaftlicher Unsichtbarkeit und medizinischer Vernachlässigung. Es steht mehr auf dem Spiel als akademischer Diskurs.
Der menschliche Faktor: Forschung und Fürsorge
ME/CFS betrifft Menschen – keine Abstrakta, keine bloßen Forschungsobjekte. Es geht um Lebenswirklichkeit, Leid, verlorene (Lebens-)Zeit. Dass die wissenschaftliche Kultur Jahrzehnte gebraucht hat, um diese Krankheit ernst zu nehmen, ist nicht nur ein medizinischer Fehler, sondern ein humanistisches Versäumnis. Die Autorin Margarete Stokowski, selbst betroffen, brachte es auf den Punkt: Forschung braucht nicht nur Methodik – sondern Haltung. Eine, die auch die Würde der Kranken im Blick behält.
„Wer für Menschenrechte und Empathie eine Speichelprobe braucht, bei dem läuft etwas grundlegend falsch.“
– Margarete Stokowski, Die letzten Tage des Patriarchats
Im gesamten Psiram-Text bleibt dieser Aspekt seltsam ausgespart, als wäre Wissenschaft ein rein kognitives Spiel, losgelöst von Verantwortung. Wenn man den Grundton des Textes nicht als regelrechten Kulturpessimismus liest, bleibt zumindest der Eindruck einer intellektuellen Weltabgewandtheit, die ihre skeptische Pose für Tiefe hält – und dabei das Menschliche aus dem Blick verliert.
Skepsis ist kein Freibrief für Weltabgewandtheit. Und schon gar kein Alibi für Spott, Zynismus oder hohle Rhetorik. Wer Kritik übt, muss auch zeigen, wie es besser geht – oder zumindest anerkennen, dass andere es versuchen.
Denn das Gegenteil von Aufklärung ist nicht Irrationalität – es ist der Zynismus einer scheinbar überlegenen Perspektive. Und dieser tarnt sich gern als Skepsis. Was wir brauchen, ist aber eine aufgeklärte Skepsis, die sich nicht im Zweifel erschöpft, sondern verantwortungsvoll fragt, wohin der Zweifel führen soll.

2 Pingbacks