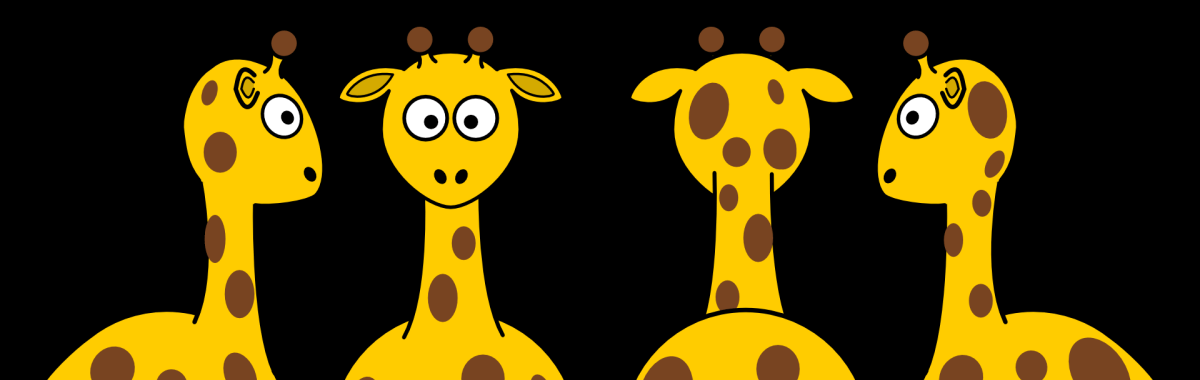
Warum statistische Halbbildung zum politischen Sedativum werden kann
Einstieg – Die trügerische Beruhigung
„Jeder zweite Haushalt besitzt mehr als 100.000 Euro.“
Mit dieser Schlagzeile eröffnete der SPIEGEL kürzlich (Spiegel online am 09.07.2025) einen Beitrag zur Vermögenssituation in Deutschland – und lieferte eine Steilvorlage für all jene, die soziale Ungleichheit lieber wegdefinieren als politisch bekämpfen wollen. Was nach guter Nachricht klingt, erweist sich bei näherem Hinsehen als ein Paradebeispiel für die Kunst, mit korrekt berechneten Zahlen ein völlig schiefes Bild der Realität zu erzeugen. Die Grundlage: eine Studie der Bundesbank, in der das sogenannte Medianvermögen deutscher Haushalte analysiert wird. Der Median – ohnehin oft missverstanden – wird hier zur statistischen Wunderwaffe gegen das schlechte Gewissen einer ungleichen Gesellschaft.
Was der Median ist – und was er nicht sagt
Der Median ist per Definition der Wert, der eine Verteilungsmenge in zwei gleich große Hälften teilt. Er ist robust gegenüber Extremwerten – und genau das macht ihn beliebt, wenn man eine von Ungleichheit geprägte Wirklichkeit möglichst glattgebügelt darstellen möchte.
Was er nicht zeigt:
- wie weit die Vermögen in der oberen Hälfte gestreut sind,
- wie sich das Gesamtvermögen zusammensetzt (z. B. Betriebsvermögen vs. Liquidität),
- wie viele Menschen deutlich unterhalb der 100.000-Euro-Marke leben – oder gar nichts besitzen.
Besonders fragwürdig: Aussagen wie „Jeder zweite Haushalt hat mehr als 100.000 Euro“ klingen, als sei das ein Durchschnitt. Das ist es nicht. Es heißt nur: Die ärmere Hälfte liegt unter diesem Wert – aber wie weit unterhalb? Oder besser: In welchem Ausmaß? Darüber schweigt sich der Beitrag aus.
Stellen wir uns eine kleine Gruppe von fünf Haushalten vor:
- Haushalt A: 1.000 €
- Haushalt B: 5.000 €
- Haushalt C: 100.000 €
- Haushalt D: 500.000 €
- Haushalt E: 10.000.000 €
➡️ Der Median liegt bei 100.000 € – genau bei Haushalt C.
Aber:
- Zwei Haushalte (A und B) liegen extrem weit darunter,
- zwei Haushalte (D und E) liegen noch extremer darüber,
- und vier von fünf Haushalten weichen stark vom Median ab.
Trotzdem könnte man nun schreiben:
„Die Hälfte der Haushalte besitzt mehr als 100.000 Euro.“
– was zwar formal korrekt, aber im Zusammenhang mit dem Problem der Vermögensverteilung irreführend ist.
Denn: Der Median verschweigt sowohl die Schieflage darunter als auch die Konzentration darüber.
Methodische Fallstricke – Betriebsvermögen, Alter, Eigentum
Die Bundesbank erhebt neben privatem Vermögen auch betriebswirtschaftliche Positionen – also Vermögenswerte, die typischerweise Unternehmern oder Selbstständigen zuzurechnen sind. Wer ein mittelständisches Familienunternehmen betreibt, dessen Firmenwert aber nicht verfügbar ist, mag rechnerisch „reich“ sein – in sozialpolitischer Hinsicht ist dieses „reich“ eine ganz andere Kategorie als ein Haushalt mit Sparkonto und Eigentumswohnung.
Die Aufschlüsselung nach Altersgruppen führt zur nächsten Schieflage:
„Die Studie zeigt auch, dass das Eigenheim bei der Vermögensbildung eine große Rolle spielt. Während danach nicht einmal jeder Zehnte unter 35 Jahren in den eigenen vier Wänden lebt, ist es bei den 55- bis 64-Jährigen mehr als jeder Zweite.“ Auch das ist nicht falsch, aber vollkommen irreführend, wenn man weiß, dass genau diese Altersgruppe:
– am stärksten vom Nachkriegseigentum profitiert hat,
– meist von günstigen Bau- und Finanzierungsbedingungen der 1960er/70er profitierte,
– eine Lebensarbeitszeit hinter sich hat, die in vielen Fällen noch von einem leistungsfähigen Sozialstaat und verlässlichen Lohnanstiegen begleitet wurde.
Und: Diese Gruppe stirbt langsam aus. Für die heute 40- bis 60-Jährigen gelten ganz andere Voraussetzungen – und von denen besitzt nur eine Minderheit Wohneigentum. Die Eigentumsquote Deutschlands liegt bei unter 50 % – das ist unter Industrieländern ein Negativrekord.
Warum das gefährlich ist – der ideologische Subtext
Man kann solche Zahlen schönreden – oder sie als das analysieren, was sie sind:
Ein statistisch maskiertes Sedativum, das gesellschaftliche Spannungen lindern soll, ohne ihre Ursachen zu benennen. Die Geschichte vom „Wohlstand der Mitte“ ist eine beruhigende Erzählung, die zunehmend an der Wirklichkeit vorbeigeht.
Wenn Medien wie der Spiegel – einst ein Bollwerk der kritischen Analyse – beginnen, derartige Narrative zu bedienen, muss man befürchten, dass dies nicht nur ein journalistischer Fehler ist. Es ist Teil einer gesellschaftlichen Verschiebung, in der ökonomische Ungleichheit bagatellisiert, soziale Sorgen individualisiert und politische Handlungspflicht relativiert werden.
Was gesagt werden müsste – und warum es politisch relevant ist
Deutschland ist ein Land, in dem
– Millionen Menschen über kein nennenswertes Vermögen verfügen,
– in dem Kinderarmut, Altersarmut und gesundheitlich bedingte Erwerbslosigkeit zunehmen,
– in dem selbst Facharbeiter mit Vollzeitstelle oft keine Wohnung in der Stadt bezahlen können,
– und in dem das Top-Zehntel mehr besitzt als die unteren 60 % zusammen.
Die Verwendung des Medians ohne Kontext, ohne Spannweiten, ohne Verteilungsmaße oder quantilbezogene Ergänzungen – das ist eine Form der Desinformation durch Weglassen. Wer daraus ableitet, Deutschland sei „im Grunde wohlhabend“, setzt dem sozialen Sprengstoff eine Zündschnur an.
Eine freie Gesellschaft lebt von Aufklärung, nicht von statistischer Beruhigung. Wer die sozialen Spannungen in diesem Land ernst nimmt, muss über Verteilung sprechen – nicht über Scheinsicherheiten. Der Median ist eine Kennzahl, keine Entwarnung. Und Journalismus darf kein Placebo sein.
