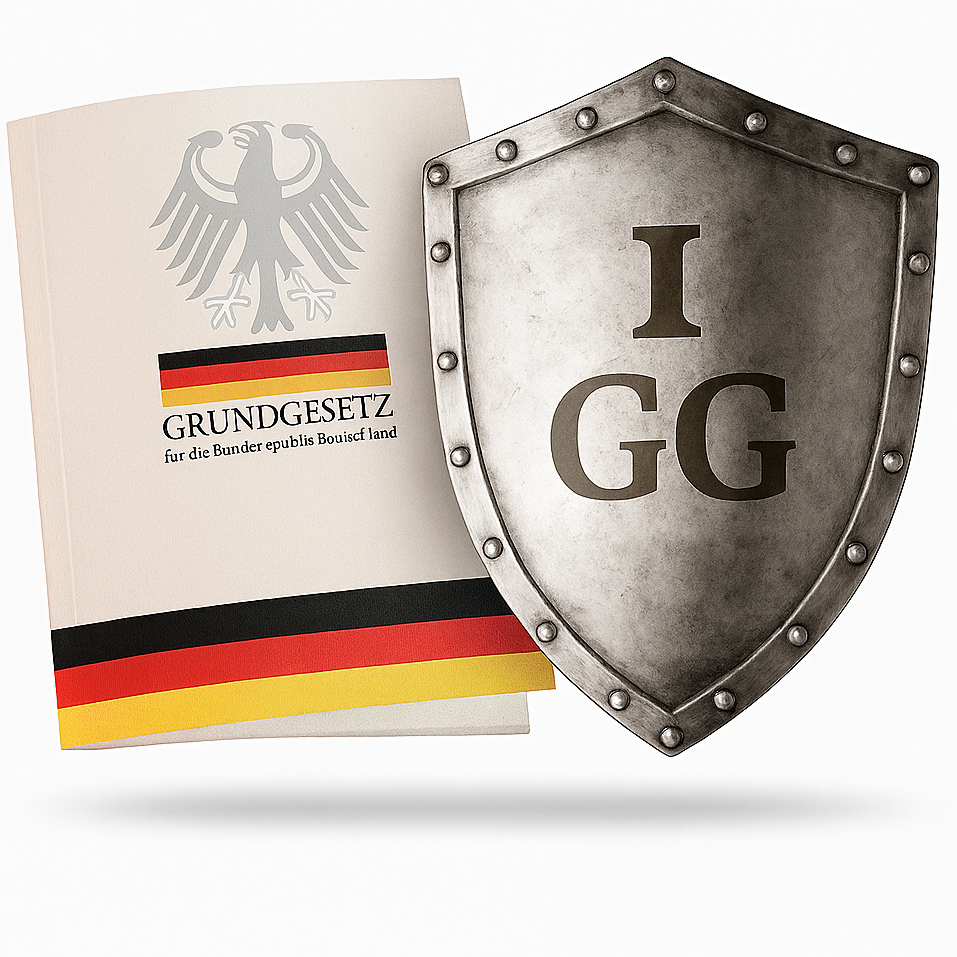Warum über Arbeit geredet wird, wenn über Nachfrage gesprochen werden müsste
Dieser Text kann als Fortführung meines Artikels „Mehr Arbeiten ist keine Wirtschaftspolitik“ beim Humanistischen Pressedienst gelesen werden.

In der aktuellen wirtschaftspolitischen Debatte fällt ein bemerkenswertes Missverhältnis auf: Über Arbeitszeit, Leistungsbereitschaft und individuelle Anstrengung wird ausgiebig gesprochen – über Nachfrage, Investitionen und makroökonomische Steuerung hingegen kaum.… Weiterlesen ...