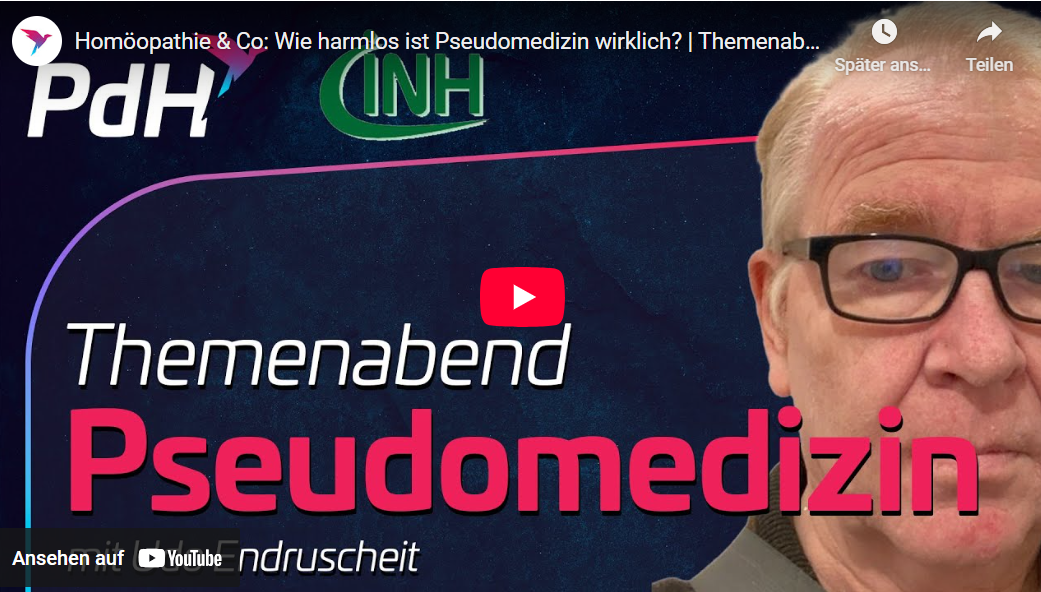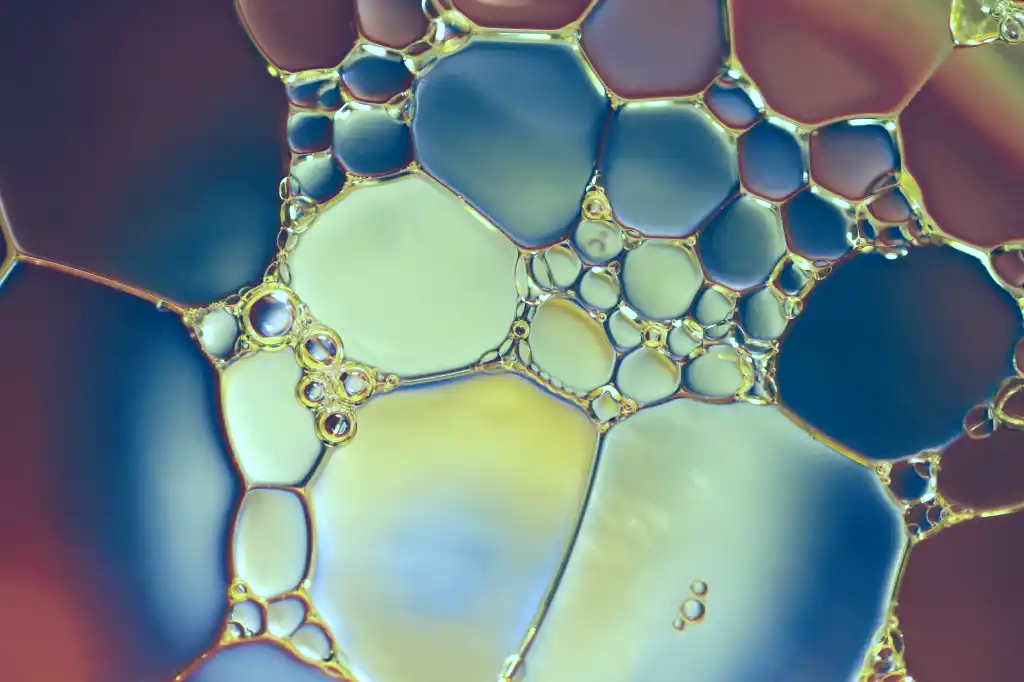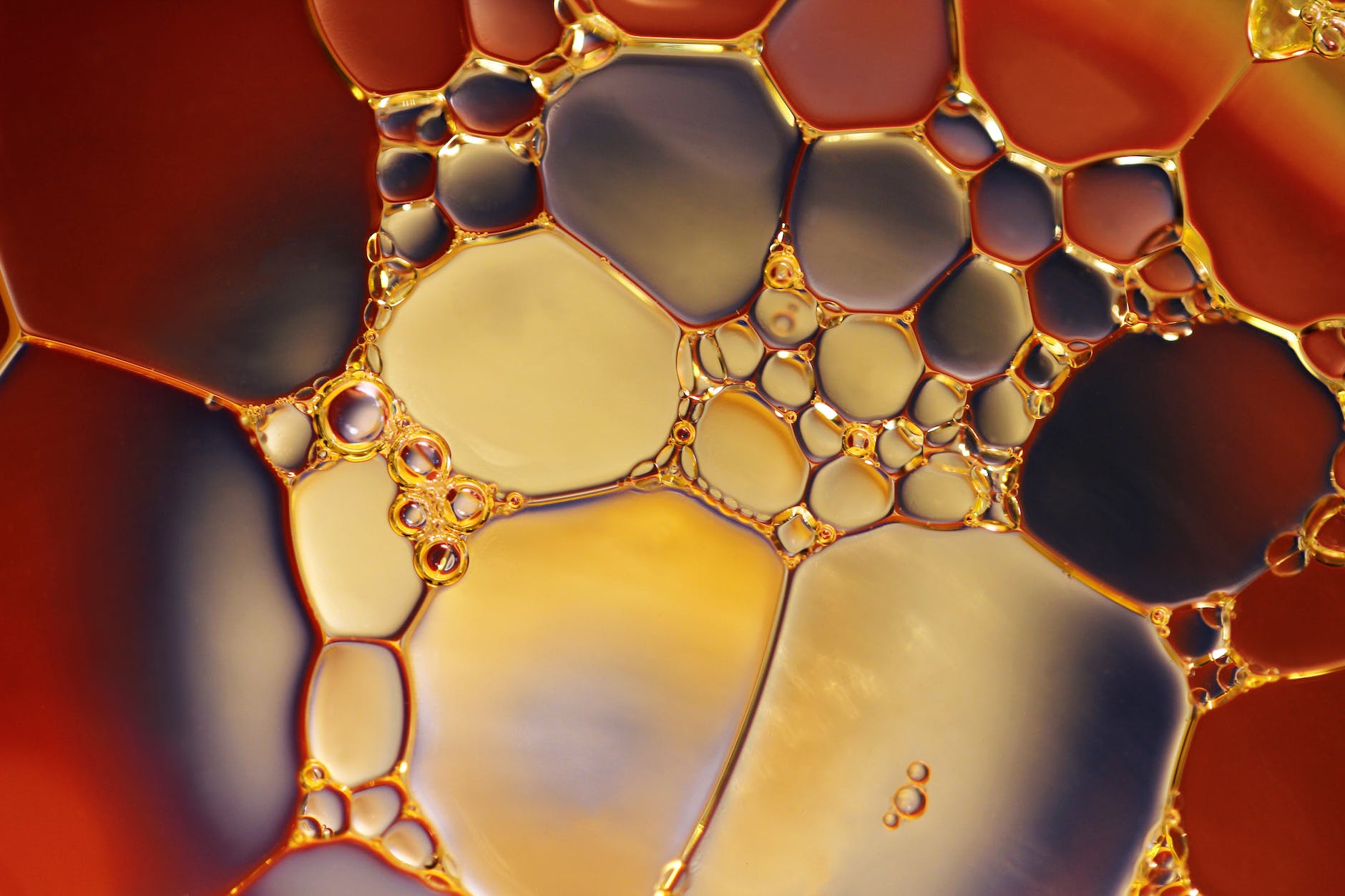Der Etikettenschwindel homöopathischer Arzneimittel zwischen AMG und SGB V
Einleitung
Die öffentliche Diskussion um Homöopathie kreist oft um Fragen von Wirkprinzipien, Placeboeffekten oder Therapiefreiheit. Weit weniger bekannt – und juristisch weitaus interessanter – ist jedoch die systematische Verwischung von Zulassung, Wirksamkeit und Erstattungsfähigkeit im deutschen Gesundheitswesen. Homöopathische Arzneimittel dürfen in Verkehr gebracht und in bestimmten Fällen sogar von gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden – ohne dass sie einen Wirksamkeitsnachweis im medizinisch-wissenschaftlichen Sinne erbringen müssen.
Ermöglicht wird diese Abweichung durch eine Kombination aus arzneimittelrechtlicher Ausnahmezulassung (§ 38 AMG) und einem sozialrechtlichen Konstrukt, das in Fachkreisen als „sozialrechtlicher Binnenkonsens“ bekannt ist. Während das Arzneimittelgesetz sich demonstrativ über die Frage der medizinischen Evidenz ausschweigt, unterläuft das Sozialrecht seine eigenen Anforderungen an den Stand der Wissenschaft – und schafft so ein legales Einfallstor für Pseudomedizin.
Die Folge: Was rechtlich „Arzneimittel“ heißt, wird sozialrechtlich zur scheinbar medizinisch fundierten Leistung – ohne es jemals real gewesen zu sein.
Um es aber gleich klarzustellen: Was rechtlich möglich ist, muss noch lange nicht richtig sein. Worum es hier (noch) nicht geht, ist die Kritik daran, dass es solche Brüche in der Gesundheitsgesetzgebung überhaupt gibt und warum die Politik mit deren Duldung und Fortschreibung gegen elementare Prinzipien und auch gegen selbstgesetzte Regeln verstößt.
1. § 38 AMG – Die arzneimittelrechtliche Sonderzone
Homöopathische Mittel benötigen in Deutschland keinen „klassischen“, also wissenschaftlichen Standards und Kriterien genügenden Wirksamkeitsnachweis, um als Arzneimittel gelten zu dürfen. Statt einer Zulassung nach dem üblichem Verfahren gemäß § 21 AMG genügt ihnen eine bloße Registrierung nach § 38 AMG. Voraussetzung ist lediglich:
- eine plausible (?) Anwendungsbegründung auf Grundlage homöopathischer Lehre,
- ein ausreichender Sicherheitsnachweis,
- und der Ausschluss von spezifischen Indikationsangaben.
Wirksamkeit im wissenschaftlichen Sinne ist nicht erforderlich. Das AMG gibt dazu keinen Hinweis – und genau das ist beabsichtigt. In der Gesetzesbegründung wird deutlich, dass es dem Gesetzgeber auch nicht darum ging, eine medizinisch-therapeutische Bewertung vorzunehmen, sondern vielmehr einen Kompromiss mit den Herstellern homöopathischer Mittel zu schaffen. Die Arzneimitteleigenschaft wird damit formal, aufgrund einer rechtlichen Fiktion, vergeben, nicht aufgrund empirischer Daten, sondern durch juristischen Akt. Der Ausschluss von Indikationsangaben ist das Indiz dafür, dass etwas wie medizinische Wirksamkeit im Zusammenhang mit der Registrierung nach § 38 AMG keine Rolle spielte – der Gesetzgeber wollte ersichtlich dieses Terrain gar nicht betreten und auch nicht suggerieren, es gebe spezifische Wirksamkeitsbelege für registrierte Homöopathika.
2. BSG-Rechtsprechung zum §38 AMG
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in mehreren Urteilen denn auch ausdrücklich klargestellt, dass die Registrierung eines Homöopathikums keinen Rückschluss auf eine medizinische Wirksamkeit erlaubt. Insbesondere im Urteil vom 24.06.2008 – B 1 KR 5/07 R stellte das Gericht unmissverständlich fest:
„Der Umstand, dass ein Mittel gemäß §38 AMG registriert ist, sagt nichts über seine Wirksamkeit oder seine therapeutische Zweckmäßigkeit im Sinne des SGB V aus.“
Damit differenziert das BSG klar zwischen formaler Zulassung und medizinischem Nutzen – eine Unterscheidung, die im arzneimittelrechtlichen Kontext durchaus scharf gezogen wird. Homöopathika sind also rechtlich Arzneimittel, medizinisch jedoch nicht evidenzbasiert.
3. Die Brücke ins System: Sozialrechtlicher Binnenkonsens
So klar die Abgrenzung im Arzneimittelrecht formuliert ist, so schwammig wird es im Sozialrecht. Die gesetzlichen Regelungen des SGB V verlangen zwar auch hier, dass Leistungen „dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse“ entsprechen (§ 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V). Doch genau an dieser Stelle etabliert sich ein Mechanismus, der diesen Grundsatz aushebelt: der sozialrechtliche Binnenkonsens.
Dieses Konstrukt ist nicht gesetzlich definiert, sondern wurde durch Rechtsprechung, insbesondere des Bundessozialgerichts, etabliert. Also ausgerechnet von der Instanz, die arzneimittelrechtlich eine klare Grenze zieht. Es bezeichnet die Praxis, Leistungen auch dann als erstattungsfähig zuzulassen, wenn sich die Partner der gemeinsamen Selbstverwaltung (z. B. Kassenärztliche Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband) darauf verständigen – selbst dann, wenn ein medizinisch-wissenschaftlicher Wirksamkeitsnachweis fehlt oder fraglich ist.
Die entscheidende Wendung findet sich im Urteil BSG, 28.02.2008 – B 1 KR 19/07 R, in dem das Gericht sinngemäß urteilt:
„Der sozialrechtliche Konsens kann eine Leistung auch dann rechtfertigen, wenn der medizinische Erkenntnisstand noch ungesichert ist.“
Damit wird die evidenzbasierte Anforderung aus § 2 SGB V relativiert – und zwar durch eine Art systeminterne Übereinkunft. Medizinische Evidenz wird durch politischen oder berufsständischen Konsens ersetzt.
4. Die Rolle der Selbstverwaltung und die Taktik über Satzungsleistungen
Die Selbstverwaltungspartner – also v. a. die Krankenkassen und ihre Verbände – nutzen diesen juristischen Spielraum auf unterschiedliche Weise. Eine zentrale Möglichkeit besteht in der Nutzung von Satzungsleistungen (§ 11 Abs. 6 SGB V). Hier können Kassen freiwillige Zusatzangebote in ihre Satzung aufnehmen, auch ohne belastbaren medizinischen Wirkungsnachweis, solange sie das Wirtschaftlichkeitsgebot formell einhalten. Was dadurch geschieht, dass die Kassen sich durch solche Offerten mehr Zulauf an jungen, zahlungskräftigen und gesundheitsbewussten Neuzugängen erhoffen bzw. die Abwanderung Gutverdienender verhindern würden. Was allerdings recht zweifelhaft ist.
So finden sich Homöopathie oder anthroposophische Therapien bis heute in Satzungen vieler Krankenkassen – nicht weil sie wirken, sondern weil sie sich gut verkaufen. Oder, in der Lesart der Lobby und auch vieler Krankenkassen: weil sie beliebt sind. Allerdings findet sich Beliebtheit nicht in den Kriterien des § 2 SGB V. Und die Geschäftsführungsrichtlinien einer Kaufhauskette auch nicht in den Geschäftsordnungen der gesetzlichen Krankenkassen.
Der juristische Trick ist dabei nicht trivial, sondern ein Spiel über Bande:
- Homöopathika erhalten durch § 38 AMG eine formale Arzneimittelzulassung – ohne Wirkungsnachweis.
- Die Sozialrechtsprechung erkennt diese formale Zulassung nicht als Wirksamkeitsbeleg an – lässt aber zu, dass die Kassen solche Mittel erstatten, wenn sie es freiwillig tun.
- Der Binnenkonsens ersetzt die wissenschaftliche Evidenz durch ein kartellartiges Einvernehmen innerhalb des Systems.
5. Die juristische Asymmetrie: AMG vorsichtig – SGB permissiv
Was dabei entsteht, ist eine paradoxe Asymmetrie zwischen Arzneimittelrecht und Sozialrecht. Während das AMG sich bewusst nicht zur Wirksamkeit äußert, wird im sozialrechtlichen Vollzug aus dieser Leerstelle eine faktische Legitimation konstruiert. Besonders absurd wirkt das in Fällen, in denen Hersteller oder Befürworter den Eindruck erwecken, die Erstattungsfähigkeit sei ein Beweis für medizinischen Nutzen.
Im Gegenteil: Sie ist lediglich der Beweis für ein gesetzlich ermöglichtes Aushebeln von Evidenzprinzipien durch administrative Arrangements. Oder anders: Sie ist der Beweis dafür, dass die Gesundheitsgesetzgebung im Stile eines Schweizer Käses reichlich Löcher aufweist, die entgegen den generellen, im Gesetz selbst festgelegten Prinzipien ein Eindringen wissenschaftlich unbelegter Mittel und Merhoden ins Gesundheitssystem ermöglicht.
6. Der Fall Hevert – Wirtschaftliches Interesse und die Illusion therapeutischer Legitimation
Ein exemplarischer Fall für die Diskrepanz zwischen juristischer Zulässigkeit und medizinischer Unhaltbarkeit ist der Abmahnversuch der Firma Hevert Arzneimittel gegen Dr. Natalie Grams im Jahr 2019. Grams hatte – fachlich korrekt – öffentlich erklärt, Homöopathika verfügten über keinen belastbaren Wirkungsnachweis. Hevert ließ ihr daraufhin eine Unterlassungserklärung unter Strafandrohung für jeden Fall der Zuwiderhandlung zustellen.
Was als Machtdemonstration gedacht war, entpuppte sich allerdings als strategisches Eigentor: Der mediale und öffentliche Druck war so hoch, dass Hevert die juristische Auseinandersetzung weitgehend still beendete bzw. nicht weiter verfolgte. Natalie Grams weigerte sich, die Unterlassungserklärung zu unterschreiben, unterstützt durch juristisch und sachlich fundierte Hintergrundarbeit.
Erstaunlich ist die nachfolgende Selbstauskunft eines Hevert-Geschäftsführers in einem Interview mit einer pharmazeutischen Fachzeitschrift: Auf die Frage, ob er die Wirksamkeit homöopathischer Mittel beurteilen könne, erklärte er sinngemäß, er sei Betriebswirt – und daher nicht zuständig für medizinische Fragen.
Diese Aussage offenbart die eigentliche Logik hinter der Pseudomedizin im Kassensystem: Es geht nicht um Wirkung, sondern um wirtschaftliche Verwertbarkeit. Das juristische Konstrukt der arzneimittelrechtlichen Zulassung und die sozialrechtliche Öffnung durch Binnenkonsens und Satzungsregelungen bieten genau dafür die ideale Infrastruktur – auf Kosten der Integrität des Gesundheitswesens.
7. Zulassung durch die Hintertür – Die Kommission D und das gesetzlich abgesicherte Evidenzvakuum
Neben der Registrierung homöopathischer Mittel nach § 38 AMG gibt es in Deutschland auch den formal „höherwertigen“ Weg der Zulassung mit Indikation – ein Verfahren, das für Homöopathika ausschließlich über die sogenannte Kommission D beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) führt. Die Kommission D ist ein eigens eingerichtetes Sachverständigengremium für die „besonderen Therapierichtungen“, das Empfehlungen für die Zulassung von Arzneimitteln auf Grundlage alternativmedizinischer Kriterien abgibt.
Rechtsgrundlage ist § 25 Abs. 6 AMG, der dem BfArM erlaubt, zur Bewertung der Zulassung von Arzneimitteln nach besonderer Therapierichtung spezielle Sachverständige zu bestellen. Formal klingt das unproblematisch – in der Praxis bedeutet es: Die Kommission besteht überwiegend aus Vertreter:innen der jeweiligen Richtung selbst, insbesondere homöopathisch tätigen Ärzt:innen und Apotheker:innen.
Mit der Möglichkeit zur Zulassung homöopathischer Arzneimittel durch die Kommission D wird diese Scheinwelt nicht etwa korrigiert, sondern auf eine höhere Stufe formaler Legitimation gehoben. Denn im Gegensatz zur Registrierung nach § 38 AMG handelt es sich bei den von der Kommission D befürworteten Mitteln tatsächlich um vollwertige Zulassungen nach § 25 AMG – mit Indikation und verordnungsfähigem Status.
Doch diese Zulassung basiert nicht auf empirisch gesicherter Evidenz, sondern auf einem gesetzlich eigens eingeräumten Sonderweg: Die Berufung auf die „medizinischen Erfahrungen der jeweiligen Therapierichtung“ ersetzt den Wirksamkeitsnachweis, unterläuft das wissenschaftliche Prinzip und macht die Kommission D zur amtlich legitimierten Ausnahmekammer für nicht evidenzbasierte Verfahren.
Dass daraus ein Arzneimittel mit offizieller Zulassung wird, darf nicht zur Verwechslung mit einem therapeutisch wirksamen Arzneimittel im wissenschaftlichen Sinne führen. Die Zulassung durch die Kommission D ist ebenfalls kein Wirksamkeitsnachweis – sie ist eine formalrechtliche Konstruktion, deren epistemischer Gehalt bei null liegt. Eine Konsensentscheidung innerhalb einer Therapierichtung schließt eine unabhängige Überprüfung aus und ist damit „der endgültige Beweis der Unwissenschaftlichkeit“ (Prof. Johannes Köbberling).
Diese Konstellation ist mehr als eine gesetzliche Ausnahme. Sie ist ein bewusst implementierter epistemologischer Sonderweg, durch den eine Parallelwelt medizinischer Geltung im Gesetz selbst verankert wurde. Während das Arzneimittelgesetz ansonsten auf wissenschaftliche Standards verpflichtet, wird hier eine Schulmedizin im eigentlichen Sinne – nämlich eine Lehre mit eigener Wahrheit – legalisiert.
Die Kommission D vollzieht diese Legitimationsverschiebung im Behördenvollzug: Sie prüft nicht nach wissenschaftlicher Evidenz, sondern nach kohärenter Binnenlogik der jeweiligen Therapierichtung. Dabei gilt nicht, was sich objektiv bewährt, sondern was innerhalb der Schule als plausibel gilt.
Die Kommission D braucht dazu aber wiederum einem Weg, auf dem sie dem Grundsatz der Wissenschaftlichkeit formal ausweichen kann. Der findet sich in der Konstruktion des Gesetzes selbst. § 25 Abs. 2 AMG bestimmt eindeutig, dass die Zulassung zu versagen ist, wenn das Erkenntnismaterial nicht dem jeweils gesicherten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entspricht. Dieser Grundsatz zieht sich durch alle Anforderungen des Arzneimittelrechts.
Doch bei Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen greift eine Sonderklausel – und sie findet sich in einem Nebensatz des § 22 Abs. 3 AMG:
„Zu berücksichtigen sind ferner die medizinischen Erfahrungen der jeweiligen Therapierichtungen.“
Damit ist faktisch ein Ausnahmetatbestand für alles geschaffen, was sich auf historische, schulenspezifische oder erfahrungsbasierte Anwendungen beruft – unabhängig davon, ob diese medizinisch plausibel oder wissenschaftlich überprüfbar sind. Die Verpflichtung auf wissenschaftliche Evidenz wird an dieser Stelle nicht nur relativiert, sondern systematisch ausgesetzt.
Der Gesetzgeber ermöglicht damit eine Form staatlich zertifizierter Unwissenschaftlichkeit, die in keinem anderen Bereich des Medizinrechts eine Entsprechung hat. Es handelt sich – ohne Übertreibung – um eine gesetzliche Pluralisierung von Geltungskriterien.
Demgemäß kann keine Rede davon sein, dass die Registrierung und ebensowenig die Zulassung von Homöopathika einen „Wirksamkeitsbeleg“ darstellen würden. Diese Konstruktion, von Vertretern der Homöopathie als „Hauptargument“ bei juristischen Versuchen verwendet, Kritiker mundtot zu machen, ist absurd. Die „Zulassung“ von Homöopathika auf der Grundlage einer Empfehlung der Kommission D beschränkt sich auf die Zuerkennung der Arzneimitteleigenschaft mit der Folge des Zugangs zum ersten Arzneimittelmarkt – also apothekenpflichtig und verordnungsfähig.
Der Irrtum Kölner Verwaltungsrichter zur Wirksamkeit homöopathischer Mittel
Ein bemerkenswerter juristischer Kurzschluss findet sich in einem Urteil des Verwaltungsgerichts Köln aus dem Jahr 2019 (Az. 7 K 8777/17), das weitreichende Fehlinterpretationen in das Arzneimittelrecht hineinliest: Das Gericht meinte, die vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehene „juristische Erstreckung des Arzneimittelbegriffs auf Homöopathika“ bedeute zugleich eine Erstreckung des Begriffs der therapeutischen Wirksamkeit auf diese Mittel. Damit unterstellt es – gegen den klaren Gesetzeswortlaut – einen gesetzlich fingierten Wirksamkeitsstatus, wo tatsächlich nur eine arzneimittelrechtliche Sonderbehandlung ohne wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis vorliegt.
Dieser Irrtum ist nicht nur offensichtlich, sondern rechtssystematisch unhaltbar:
- § 25 Abs. 2 AMG verlangt für eine Zulassung grundsätzlich den Nachweis einer therapeutischen Wirksamkeit anhand des gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnismaterials – eine Anforderung, die bei Homöopathika gerade nicht erfüllt wird.
- Die Sonderregelung über die Kommission D erlaubt ausnahmsweise die Berücksichtigung von „Erfahrungen aus der jeweiligen Therapierichtung“ – was ausdrücklich keine gleichwertige Evidenz im Sinne evidenzbasierter Medizin darstellt, sondern eine gesetzlich begründete Abweichung von der Norm.
- Daraus eine konkludente Wirksamkeitsfiktion abzuleiten, verkehrt die gesetzliche Ausnahme zur Regel und widerspricht dem teleologischen Sinn der Vorschrift: Nicht die Gleichsetzung mit echten Arzneimitteln war bezweckt, sondern lediglich eine privilegierte Marktpräsenz ohne therapeutischen Anspruch.
Der fehlerhafte Zirkelschluss des VG Köln wird dadurch besonders gefährlich, dass er einer pseudomedizinischen Deutung Vorschub leistet: Der Status als Arzneimittel suggeriert Laien bereits hinreichende Wirksamkeit – die Gerichtsentscheidung zementiert dieses Missverständnis nun auch noch juristisch. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Gerade weil Homöopathika keine nachgewiesene Wirkung besitzen, wurden sie vom Gesetzgeber in einen Sonderstatus überführt, nicht trotz, sondern wegen des Fehlens wissenschaftlicher Evidenz.
Das VG Köln begeht mit seiner Interpretation daher einen Kategoriefehler: Es vermischt die formale juristische Zulassung mit dem inhaltlich-naturwissenschaftlichen Anspruch auf Wirksamkeit. Das ist, systematisch betrachtet, nicht haltbar – und widerspricht dem erkennbaren Zweck der Ausnahmeregelungen, die gerade keine Äquivalenz zu regulären Arzneimittelzulassungen begründen sollen.
8. Wissenschaft im Rückwärtsgang – Eine Kritik an der systematischen Erosion
Die deutsche Gesetzeslage im Arzneimittel- und Sozialrecht kennt – auf dem Papier – eine klare Leitlinie: Medizinische Verfahren und Arzneimittel müssen dem gesicherten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen. Dieser Satz zieht sich durch das AMG ebenso wie durch das SGB V. Doch in der Praxis ist dieser Standard löchrig wie ein Schleppnetz, das ein Blauwal ungehindert passieren könnte.
An strategischen Stellen wurden Hintertüren eingebaut, durch die nicht evidenzbasierte Verfahren systematisch in das Gesundheitssystem gelangen:
- durch die Registrierung nach § 38 AMG und die daran geknüpfte fiktive Arzneimitteleigenschaft,
- durch die Kommission D und die Sonderbehandlung in § 22 Abs. 3 AMG,
- durch den sozialrechtlichen Binnenkonsens als Begründung für Erstattungsfähigkeit,
- und durch die Möglichkeit freiwilliger Satzungsleistungen ohne Wirksamkeitsnachweis.
Jede einzelne dieser Regelungen wäre für sich genommen ein Problem. Zusammen jedoch ergeben sie ein gesundheitsrechtliches Subsystem, das in sich logisch funktioniert, aber von den epistemischen Prinzipien moderner Medizin weitgehend entkoppelt ist und der verbraucherschützenden Absicht, die ursprünglich die Intention für den Erlass des AMG war, diametral entgegensteht.
Der Begriff der „medizinischen Erkenntnis“ wird dabei nicht konsequent angewandt, sondern selektiv suspendiert – je nachdem, welches politische Zugeständnis oder welcher ökonomische Nutzen gerade im Vordergrund steht. Das ist kein Versehen, sondern Ergebnis bewusster Entscheidungen. Und es ist der vielleicht folgenreichste Bruch im normativen Gefüge der deutschen Gesundheitsgesetzgebung seit Inkrafttreten des AMG.
Wer heute behauptet, Homöopathie sei Teil des medizinischen Systems, weil sie zugelassen und erstattungsfähig sei, verwechselt Gesetzesrealität mit Wissenschaft.
Was formal möglich ist, ist epistemisch noch lange kein Fortschritt – es ist in diesem Fall Rückschritt mit System.
7. Fazit und politische Forderungen
Das Nebeneinander von § 38 AMG und sozialrechtlichem Binnenkonsens schafft eine juristische Scheinwelt: Homöopathische Mittel dürfen verkauft, erstattet und beworben werden, ohne je ihre medizinische Wirksamkeit bewiesen zu haben – allein durch regulatorisches Etikett und systeminternen Konsens.
Diese Praxis unterläuft nicht nur das Wirtschaftlichkeitsgebot des § 12 SGB V, sondern auch die Verpflichtung zu evidenzbasierter Versorgung im Sinne des § 2 SGB V. Sie widerspricht der Patientenaufklärung, schwächt das Vertrauen in die gesetzlichen Krankenkassen und konterkariert die Prinzipien einer modernen, wissenschaftsgeleiteten Gesundheitspolitik.
Was juristisch erlaubt ist, ist deswegen noch lange nicht gerechtfertigt. Medizinisch nicht. Und politisch schon gar nicht.
Was wäre zu tun?
- Die Abschaffung des sozialrechtlichen Binnenkonsenses als faktische Parallelstruktur zur evidenzbasierten Medizin.
- Die Streichung homöopathischer und anderer pseudomedizinischer Leistungen der besonderen Therapierichtungen aus allen Satzungen und Selektivverträgen gesetzlicher Krankenkassen.
- Eine gesetzliche Klarstellung, dass Arzneimittel im Sinne des § 38 AMG nicht als medizinisch wirksam im Sinne des SGB V gelten, solange kein wissenschaftlicher Wirknachweis vorliegt.
- Eine politische Debatte über die ethische Verantwortung, nicht nur evidenzbasierte Versorgung zu fordern, sondern sie auch gegen wirtschaftliche Interessen durchzusetzen.
Schlussexkurs: Das EU-Registrierungsregime für Homöopathika – ein Missverständnis mit System
1. Einleitung
In Diskussionen um die rechtliche Stellung homöopathischer Arzneimittel wird häufig auf das EU-Recht verwiesen – insbesondere auf das verpflichtende Registrierungsverfahren nach Richtlinie 2001/83/EG. Daraus wird mitunter die Schlussfolgerung gezogen, Homöopathika seien „EU-anerkannte“ Arzneimittel und ihre nationale Erstattung oder formale Gleichbehandlung mit evidenzbasierten Medikamenten sei eine zwangsläufige Folge europarechtlicher Vorgaben.
Diese Argumentation ist irreführend. Die EU-Vorgaben betreffen ausschließlich die formale Verkehrsfähigkeit im Binnenmarkt. Sie begründen weder einen medizinischen Status noch eine Pflicht zur Integration in nationale Erstattungssysteme.
2. Die EU-Richtlinie 2001/83/EG – Ziel und Reichweite
Mit der Richtlinie 2001/83/EG wurde europaweit ein harmonisierter Rechtsrahmen für das Inverkehrbringen von Arzneimitteln geschaffen. Artikel 14 bis 16 dieser Richtlinie sehen ein vereinfachtes Registrierungsverfahren für bestimmte homöopathische Arzneimittel vor, sofern sie:
- für orale oder äußerliche Anwendung bestimmt sind,
- keine spezifischen Indikationen tragen,
- eine ausreichende Verdünnung aufweisen (Unbedenklichkeit), d.h. mindestens die Potenzierungsstufe C 4 aufweisen,
- nach homöopathischer Herstellpraxis produziert wurden.
Diese Vorschriften verpflichten die Mitgliedstaaten zur Einrichtung eines formalen Registrierungsverfahrens. Sie betreffen jedoch ausschließlich die Voraussetzungen für die Marktzulassung unter Sicherheitsaspekten – nicht die therapeutische Bewertung oder medizinische Legitimation.
3. Keine Verpflichtung zur Erstattung oder Gleichstellung
Die Richtlinie 2001/83/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, registrierte homöopathische Mittel:
- als Arzneimittel im medizinisch-fachlichen Sinne zu klassifizieren,
- mit evidenzbasierten Medikamenten gleichzustellen,
- oder in ihre sozialrechtlichen Erstattungssysteme zu integrieren.
Die Entscheidung, Homöopathika in Deutschland trotz fehlender Evidenz als Arzneimittel zu bezeichnen und sie im Rahmen freiwilliger Satzungsleistungen gesetzlicher Krankenkassen zu erstatten, ist allein das Ergebnis nationaler politischer und gesetzgeberischer Entscheidungen.
4. Wissenschaftliche Position: EASAC-Stellungnahme 2017
Der European Academies Science Advisory Council (EASAC) – ein Zusammenschluss der nationalen Akademien der Wissenschaften der EU-Mitgliedstaaten – hat 2017 eine unmissverständliche Stellungnahme veröffentlicht:
„There is no known disease for which there is robust, reproducible evidence that homeopathy is effective beyond placebo.“
Die EASAC fordert u. a.:
- Keine Erstattung durch öffentliche Gesundheitssysteme,
- Keine Sonderstellung im Arzneimittelrecht,
- Einheitliche Kennzeichnungs- und Werbevorgaben auf wissenschaftlicher Basis.
Diese Stellungnahme unterstreicht: Das europäische Wissenschaftsestablishment betrachtet eine Sonderbehandlung der Homöopathe als unhaltbar. Von Rechtsfolgen im Hinblick auf einen Arzneimittelstatus oder einen Platz in Erstattungssystemen durch die Regelung des Registrierungssystems in der Richtlinie geht der EASAC ersichtlich nicht aus – sonst hätte er deren Korrektur als Voraussetzung für die Umsetzung seiner Vorschläge erwähnen müssen.
5. Fazit
Das EU-Registrierungsregime für Homöopathika ist ein Mindeststandard zur Verkehrsfähigkeit unter Sicherheitsaspekten. Es verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht zur Vergabe eines medizinischen Status und nicht zur sozialrechtlichen Integration.
Die deutsche Praxis, Homöopathika im nationalen Recht als „Arzneimittel“ zu etikettieren und ihre Erstattung zuzulassen, ist nicht EU-rechtlich erzwungen, sondern politisch gewollt. Sie steht im offenen Widerspruch zu wissenschaftlichen Standards – und zur Position der europäischen Wissenschaftsakademien, einschließlich der deutschen Leopoldina.