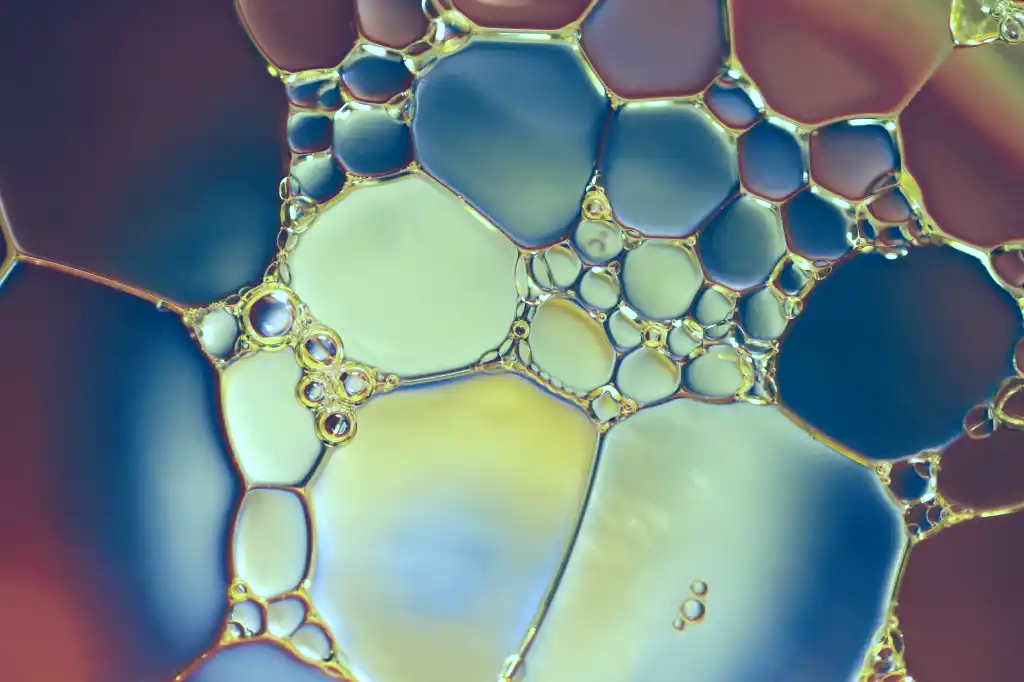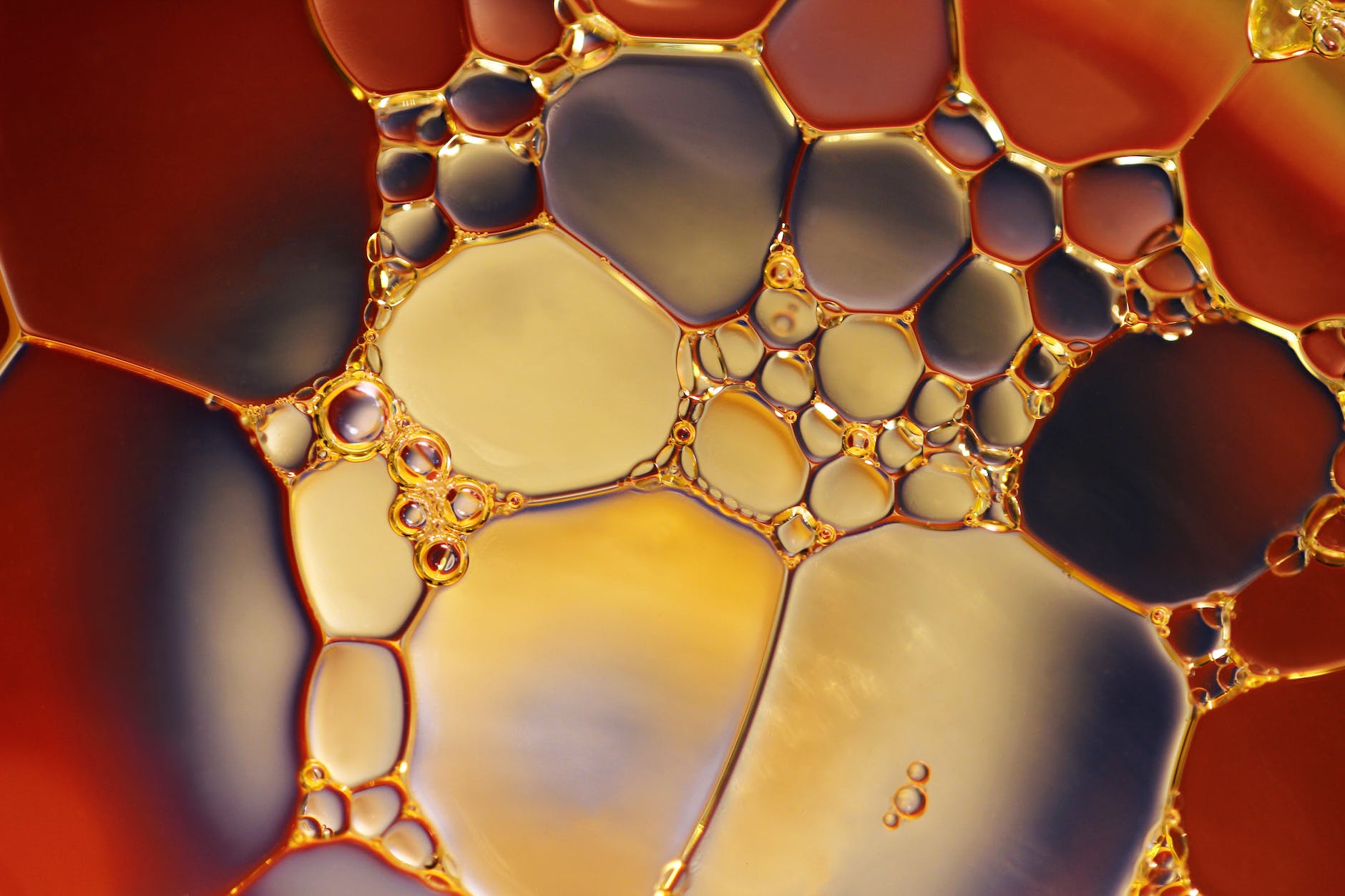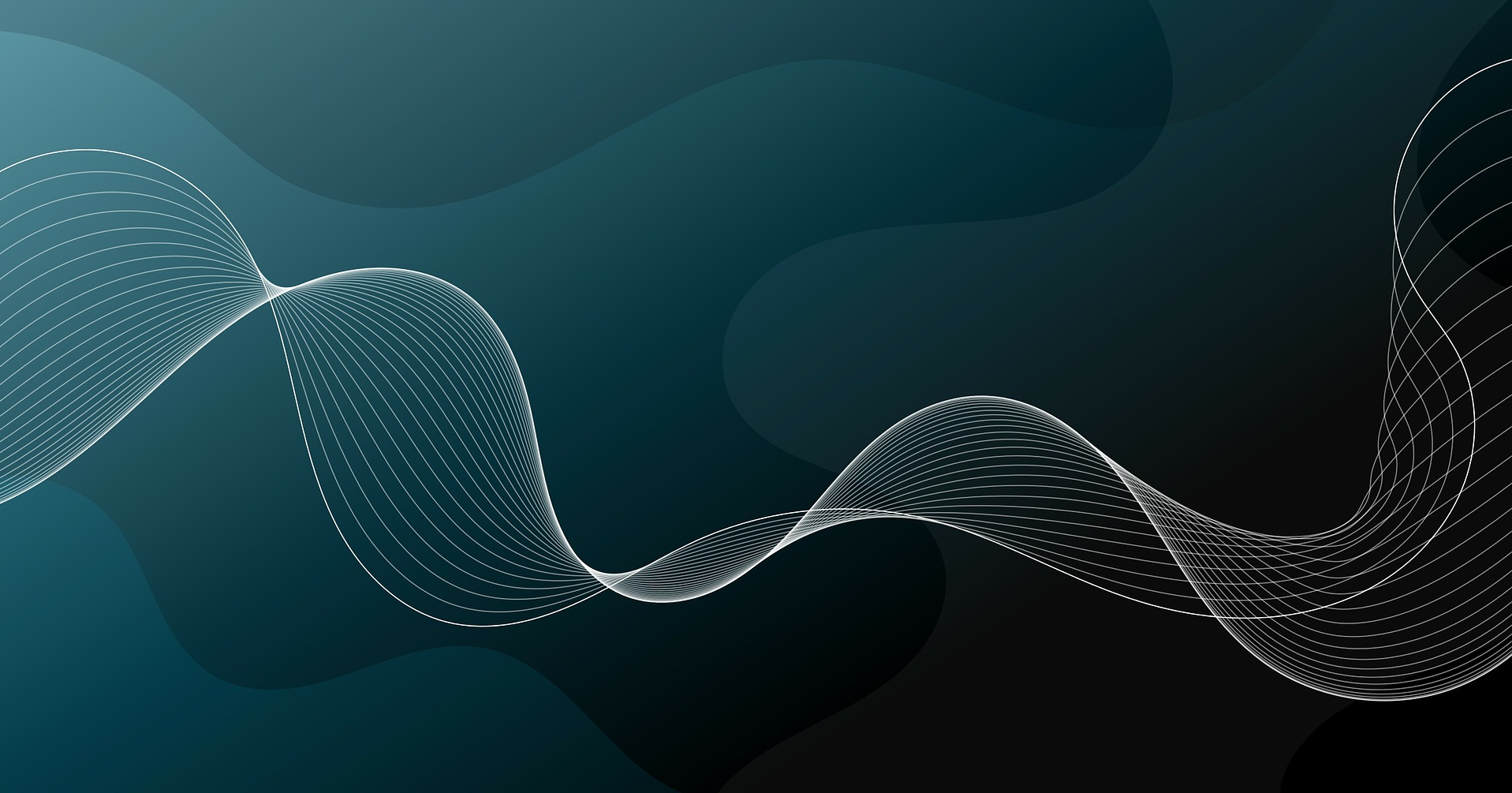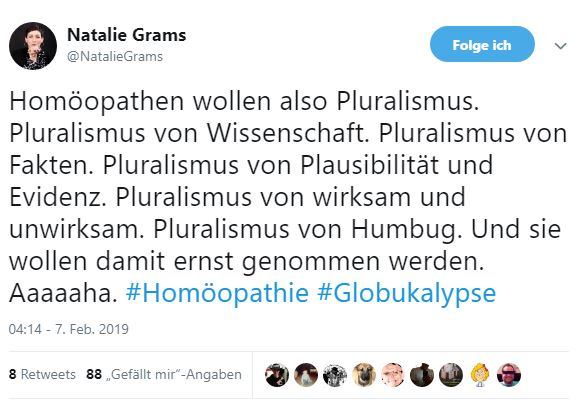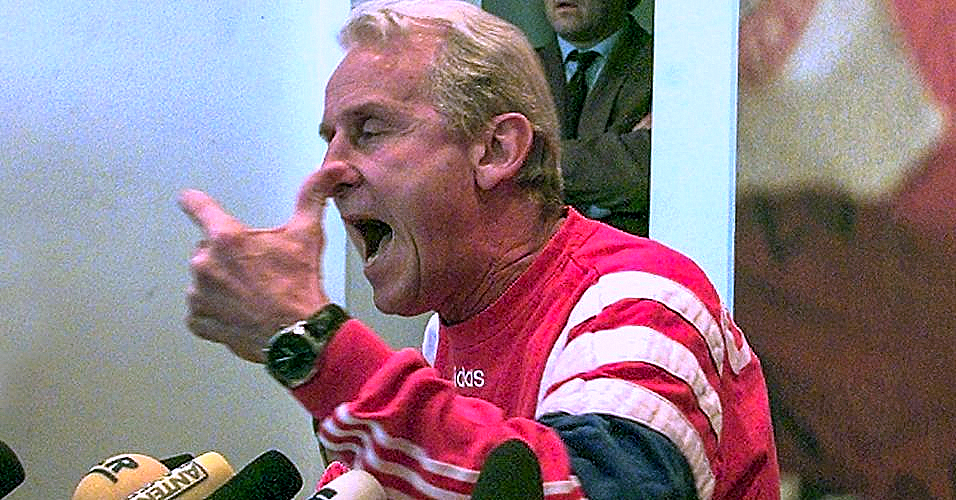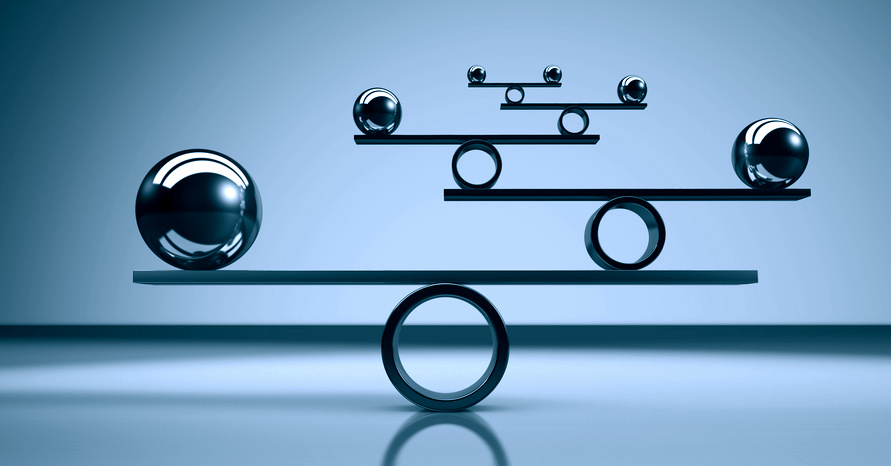I.
Übersicht über die indikationsübergreifenden Reviews / Metaanalysen zur Homöopathie seit 1991
Kleijnen (1991)
„Derzeit sind die Nachweise aus klinischen Studien positiv, aber sie sind nicht ausreichend, endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen, weil die Methodik in den meisten Studien von geringer Qualität ist und der Einfluss des „Publication bias“ unbekannt ist.“
Kleijnen J et al: Clinical trials of homeopathy, BMJ 1991; 302:316-23
Linde (1997)
„Das Ergebnis unserer Meta-Analyse liefert keine Bestätigung für die Hypothese, die klinischen Effekte der Homöopathie bestünden alleine aus einer Placebowirkung. Wir fanden in diesen Studien jedoch nur unzureichende Nachweise dafür, dass die Homöopathie auch nur bei einem einzigen Krankheitsbild wirksam wäre.“
Linde (1998)
„Die Ergebnisse der vorliegenden randomisierten kontrollierten Studien deuten darauf hin, dass die Homöopathie eine über Placebo hinausgehende Wirkung aufweist. Die Nachweise sind jedoch wegen methodischer Schwächen und Widersprüchlichkeit nicht überzeugend.“
Cucherat (2000)
„Es gibt ein paar wenige Nachweise dafür, dass homöopathische Therapien wirksamer sind als Placebos; die Aussagekraft dieser Nachweise ist wegen der nur geringen methodischen Qualität der Studien nur gering. Studien von höherer methodischer Qualität waren eher ungünstiger als solche mit geringer Qualität.“
Cucherat M et al.: Evidence of clinical efficacy of homeopathy, Eur. J Clin Pharmacol 2000;56:27-33
Shang (2005)
„… es zeigten sich schwache Nachweise für einen spezifischen Effekt der homöopathischen Arzneien (…) Die Ergebnisse bestätigen den Eindruck, dass es sich bei den klinischen Effekten der Homöopathie um Placeboeffekte handelt.“
Die Shang-Studie, von der Schweizer Bundesregierung zur Evaluation komplementärmedizinischer Methoden in Auftrag gegeben, führte zu dem Lancet-Editorial vom „Ende der Homöopathie“ und in der Folge zu langandauernden Kontroversen um die Arbeit (die noch heute gelegentlich aufflackern). Auch von Homöopathiekritikern wurden einzelne Punkte bemängelt, jedoch ist es nie gelungen, die Endaussage zu Lasten der Homöopathie zu Fall zu bringen. Einen Überblick über die Diskussion zur Shang-Studie gibt es hier und hier.
Mathie (2014)
„Arzneien, die als Homöopathika individuell verordnet wurden, haben vielleicht einen kleinen spezifischen Effekt. (…) Die generell niedrige und unklare Qualität der Nachweise gebietet aber, diese Ergebnisse nur vorsichtig zu interpretieren.“
Mathie 2014 ist die wohl am häufigsten als Beleg pro Homöopathie herangezogene zusammenfassende Arbeit. Nahezu regelhaft lässt sich beobachten, dass aus dem vorstehenden Fazit nur der erste Satz zitiert und der zweite, der das ohnehin schwache Ergebnis nochmals stark relativiert, so gut wie nie angeführt wird.
NHMRC (2015)
„Es gibt keine zuverlässigen Nachweise dafür, dass die Homöopathie bei der Behandlung von Gesundheitsproblemen wirkungsvoll wäre.“
Mathie (2017)
„Die Qualität der Nachweise als Ganzes ist gering. Eine Meta-Analyse aller ermittelbaren Daten führt zu einer Ablehnung unserer Nullhypothese [dass das Ergebnis einer Behandlung mit nicht-individuell verordneten Homöopathika nicht von Placebo unterscheidbar ist], aber eine Analyse der kleinen Gruppe der zuverlässigen Nachweise stützt diese Ablehnung nicht. Meta-Analysen für einzelne Krankheitsbilder ergeben keine zuverlässigen Nachweise, was klare Schlussfolgerungen verhindert.“
Mathie (2018)
„Aufgrund der geringen Qualität, der geringen Anzahl und der Heterogenität der Studien lassen die aktuellen Daten einen entscheidenden Rückschluss auf die Wirksamkeit von IHT (individualisierten homöopathischen Therapien) nicht zu. Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse wird durch die insgesamt identifizierte variable externe Validität eingeschränkt […]. Künftige OTP-kontrollierte Studien (Anm: other than placebo, also gegen Standardtherapien oder ganz ohne Behandlung getestet) in der Homöopathie sollten so weit wie möglich darauf abzielen, sowohl die interne Validität als auch die externe Validität zu fördern.“
Antonelli /Donelli (2018)
„Wenn die Wirksamkeit der Homöopathie mit einem Placebo vergleichbar ist und eine Behandlung mit Placebo bei manchen Beschwerden wirksam sein kann, dann kann man die Homöopathie insgesamt als Placebotherapie ansehen. Die Interpretation der Homöopathie als Placebotherapie definiert Grenzen und Möglichkeiten dieser Lehre.“
Die Arbeit vergleicht Homöopathie mit sogenanntem „offenen Placebo“, also Behandlungen, bei denen den Patienten mitgeteilt wird, dass sie ein Placebo erhalten. Das Ergebnis stellt fest, dass die Wirksamkeit der Homöopathika der offenen Placebobehandlung entspricht.
Es scheint Intention dieser Arbeit zu sein, die Homöopathie als Placebotherapie zu „legitimieren“, was ein Kurswechsel in dem Bemühen wäre, eine Wirksamkeit der Homöopathie mit den Methoden der Evidenzbasierten Medizin nachzuweisen. Es muss allerdings der Tendenz entgegen getreten werden, auf diese Weise Homöopathie als Teil von Medizin zu rechtfertigen, was inzwischen sogar von der klinischen Placeboforschung ausdrücklich hervorgehoben wird (so Benedetti F, The Dangerous Side of Placebo Research: Is Hard Science Boosting Pseudoscience?, Clinical Pharmacology & Therapeutics Vol 106 No 6 Dec 2017).
Antonelli M, Donelli D: „Reinterpreting homeopathy in the light of placebo-effects to manage patients who seek homeopathic care: A systematic Review“, Health Soc Care Community (2018). doi: 10.1111/hsc.12681
Mathie (2019)
„Die aktuellen Daten lassen eine entscheidende Aussage über die vergleichbare Wirksamkeit von NIHT (Nichtindividualisierte homöopathische Therapie, Behandlung mit Standardmitteln) nicht zu. Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse wird durch die insgesamt festgestellte begrenzte externe Validität (Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse) eingeschränkt. Die höchste intrinsische Qualität wurde in den Äquivalenz- und Nichtunterlegenheitsstudien von NIHT beobachtet.“
Auch diesmal kommt Mathie, was die Qualität der von ihm betrachteten Studien angeht, zu einem vernichtenden Ergebnis: Von 17 eingeschlossenen Arbeiten war keine einzige mit einem „low risk of bias“, also einer ausreichenden Qualität und Aussagekraft, zu bewerten. 13 davon waren gar mit einem „high risk of bias“ einzustufen. Was dies bedeutet, ist nachstehend in der Gesamtbewertung der Studienlage erläutert.
Mathie RT et al.: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised, Other-than-Placebo Controlled, Trials of Non-Individualised Homeopathic Treatment.
Homeopathy 2019 Jan 30. doi: 10.1055/s-0038-167748
Bewertung der Gesamtevidenz aus den indikationsübergreifenden Reviews im Zeitraum von 1991 bis 2019
Reviews / Metaanalysen stellen die zuverlässigste Quelle für die Beurteilung von Evidenz dar und repräsentieren so in der Hierarchie von Evidenz die höchste Stufe. Sie fassen Einzelstudien bzw. vorherige Analysen unter Berücksichtigung der Qualität und Validität ihrer Ergebnisse zusammen und ermöglichen so eine Gesamtschau auf die Evidenzlage zu medizinischen Methoden / Mitteln.
Die Ergebnisse der großen indikationsübergreifenden Reviews zur Homöopathie ergeben durchweg ein einheitliches Fazit: Man erhält auf den ersten Blick den Eindruck, dass es einen gewissen Nutzen geben könnte. Aber bei der – elementar wichtigen – Einbeziehung der Qualität der Aussagen in die Betrachtung oder bei dem Versuch, konkret festzustellen, für wen sich unter welchen Bedingungen sich ein Nutzen ergibt, verschwindet der positive Eindruck und zeigt sich als Trugschluss.
Zusammengefasst: Die Gesamtevidenz zur Homöopathie stellt sich so dar, dass es keinen belastbaren Nachweis dafür gibt, dass Homöopathie stärker wirkt als Placebo / Kontexteffekte. Alle zitierten Arbeiten kommen zu dem gleichen Schluss, sowohl die von homöopathischer Seite heftig kritisierten Arbeiten von Shang und des NHMRC als auch die Arbeiten Mathies, der seine vier Reviews der Gesamtstudienlage für das Homeopathy Research Institute durchgeführt hat, das zu den ständigen Kritikern der nicht von Homöopathen erstellten Reviews gehört. Die vielfach euphemistisch-ausweichend formulierten „Conclusions“ der von homöopathischer Seite durchgeführten Reviews dürfen über die nirgends belegte Evidenz für die Homöopathie nicht hinwegtäuschen, nicht zuletzt, weil sie Vertretern der Homöopathie in Diskussionen die Möglichkeit bieten, scheinbar positive Aussagen (selektiv) zu zitieren.
Die stets konstatierte mangelnde Qualität der untersuchten Studien darf nicht fälschlich als Relativierung des für die Homöopathie negativen Ergebnisses verstanden werden. Fehler und methodische Unzulänglichkeiten in Studien und Studiendesign wirken sich nahezu zwangsläufig in Richtung des sogenannten Alpha-Fehlers, also eines falsch-positiven Ergebnisses, aus und nicht umgekehrt.
Dies wird auch dadurch bestätigt, dass unter Einbeziehung der qualitativ besten Arbeiten die positiv erscheinenden Effekte sich nicht verstärken, sondern tendenziell verschwinden. Dies zeigen auch viele der hier angeführten Reviews immer wieder.
In einzelnen Reviews ist sogar zu bemängeln, dass methodisch gute Studien mit einem negativen Ergebnis für die Homöopathie gänzlich unberücksichtigt geblieben sind (z.B. bei Mathie 2014, wo bei Einbeziehung dieser Arbeiten das schwache Ergebnis zugunsten der Homöopathie vollends obsolet gewesen wäre).
II
Stellungnahmen von wissenschaftlichen Organisationen und staatlichen Stellen zur Homöopathie
Russische Akademie der Wissenschaften, 2017
Deutsche Übersetzung: Informationsnetzwerk Homöopathie (2017)
„Dieses Memorandum stellt fest, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft Homöopathie heute als Pseudowissenschaft betrachtet. Ihre Verwendung in der Medizin steht im Gegensatz zu den grundlegenden Zielen der nationalen Gesundheitspolitik […].
Somit basiert die Homöopathie auf theoretischen Positionen, die in großen Teilen direkt grundlegenden wissenschaftlichen Prinzipien und Gesetzen der Physik, Chemie, Biologie und Medizin widersprechen. Keinerlei empirische Daten aus unabhängigen, hochqualitativen klinischen Studien bestätigen die klinische Wirksamkeit von homöopathischen Mitteln.“
National Health and Medical Research Council, Australien (2015)
„Die Homöopathie sollte nicht zur Behandlung chronischer, ernster oder schwerwiegender Gesundheitszustände eingesetzt werden. Menschen, die sich für die Homöopathie entscheiden, können ihre Gesundheit gefährden, wenn sie Behandlungen ablehnen oder verzögern, für die es gute Beweise für Sicherheit und Wirksamkeit gibt.“
Ungarische Akademie der Wissenschaften
Homöopathische Mittel erfüllen nicht die Kriterien der evidenzbasierten Medizin.
Schwedische Akademie der Wissenschaften
Die Aufnahme anthroposophischer und homöopathischer Produkte in die schwedische Arzneimittelrichtlinie würde mehreren Grundprinzipien für Arzneimittel und evidenzbasierte Medizin zuwiderlaufen. Es ist grob irreführend, Homöopathika als Medikamente zu bezeichnen.
US Food and Drug Administration (FDA)
Wir empfehlen Eltern und Betreuungspersonen, Kindern keine homöopathischen Kinderzahntabletten und -gele zu geben und sich von ihrem Arzt beraten zu lassen, um sichere Alternativen zu finden.
NCCIH (Nationales Zentrum für komplementäre und integrative Gesundheit), USA
Verwenden Sie die Homöopathie nicht als Ersatz für eine bewährte konventionelle Behandlung oder um den Besuch bei einem Arzt wegen eines medizinischen Problems zu verschieben.
Von der US-amerikanischen Verbraucherschutzbehörde FTC geforderte Standardkennzeichnung homöopathischer Mittel, 2016
„Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass das Produkt wirkt
Die Erklärungen zum Produkt basieren ausschließlich auf den Theorien der Homöopathie aus dem 18. Jahrhundert, die von der Mehrzahl der heutigen medizinischen Fachleute nicht akzeptiert werden.“
The House of Commons, Science and Technology Committee, 2009
Homöopathische Mittel sind nicht besser als Placebos, und die Prinzipien, auf denen die Homöopathie beruht, sind wissenschaftlich nicht plausibel.
Schlussfolgerung: Homöopathie sollte nicht vom National Health Service unterstützt werden und die MHRA (Arzneimittel-Zulassungsbehörde) sollte die Lizensierung homöopathischer Produkte beenden.
National Health Service, Vereinigtes Königreich
Es gibt keine qualitativ hochwertigen Belege dafür, dass die Homöopathie als Behandlung für irgendeine medizinische Indikation wirksam ist. Homöopathie ist im besten Falle Placebo.
Royal Pharmaceutical Society, Großbritannien, 2017
„Die Royal Pharmaceutical Society (RPS) unterstützt die Homöopathie als Behandlungsform nicht, da es weder eine wissenschaftliche Grundlage für die Homöopathie noch Belege für eine klinische Wirksamkeit homöopathischer Produkte über den Placebo-Effekt hinaus gibt.
Die RPS unterstützt keine Verschreibung homöopathischer Produkte im Rahmen des NHS (inzwischen erledigt mit der Übernahme der NHS-Empfehlungen zur Homöopathie durch sämtliche englischen Regionalorganisationen).
Apotheker sollten sicherstellen, dass Patienten die Einnahme ihrer verschriebenen konventionellen Medikamente nicht einstellen, wenn sie ein homöopathisches Produkt einnehmen oder dies in Erwägung ziehen.
Apotheker müssen sich darüber im Klaren sein, dass Patienten, die nach homöopathischen Produkten fragen, schwere, nicht diagnostizierte Krankheiten haben können, die die Inanspruchnahme eines Arztes erfordern.
Apotheker müssen Patienten, die ein homöopathisches Produkt in Betracht ziehen, über dessen mangelnde Wirksamkeit über Placeboeffekte hinaus beraten.“
Ministerium für Gesundheit, Spanien
„Die Homöopathie hat ihre Wirksamkeit in keiner bestimmten Indikation oder klinischen Situation endgültig bewiesen.“
Oberster Medizinischer Rat (NRL) der Nationalen Ärztekammer, Polen
„Die Anwendung der Homöopathie verstößt gegen die Grundsätze der medizinischen Ethik.“
Prof. Maciej Latalski, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates des polnischen Gesundheitsministers, Vorsitzender der Konferenz der Rektoren der medizinischen Universitäten in Polen (2006)
“(…) Homöopathie hat nichts mit Medizin zu tun (außer dem Phänomen des Placebos), und ihre therapeutischen Prinzipien basieren auf der pseudowissenschaftlichen Prämisse, dass “Ähnliches mit Ähnlichem behandelt werden kann.“
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Belgien / Englischsprachiger Teil
„Aus rein klinischer Sicht bleibt festzuhalten, dass es keinen gültigen empirischen Nachweis für die Wirksamkeit der Homöopathie (evidenzbasierte Medizin) über den Placeboeffekt hinaus gibt.“
European Academies Science Advisory Council (EASAC)
„Wir erkennen an, dass ein Placebo-Effekt bei einzelnen Patienten auftreten kann, aber wir stimmen mit früheren umfangreichen Evaluierungen überein, die zu dem Schluss kommen, dass es keine bekannten Krankheiten gibt, für die robuste, reproduzierbare Beweise existieren, dass Homöopathie über den Placebo-Effekt hinaus wirksam ist.“
Akademie der medizinischen Wissenschaften, Frankreich
„Homöopathie ist eine Methode, die vor zwei Jahrhunderten auf der Grundlage von a-priori-Konzepten ohne wissenschaftliche Grundlagen entwickelt wurde.“
Nationaler Rat der französischen Ärztekammern
zur Homöopathie-Debatte 2018 in Frankreich
Ohne die Freiheit kritischer oder divergierender Meinungen jedes Einzelnen im öffentlichen Raum in Frage zu stellen, fordert der Nationalrat der Ärztekammer:
- dass der Begriff „Medizin“ als Voraussetzung für jedes therapeutische Vorgehen als erstes einen medizinischen Prozess der klinischen Diagnose beinhaltet, der gegebenenfalls durch zusätzliche Untersuchungen unter Hinzuziehung kompetenter Dritter ergänzt wird;
- dass jeder Arzt Medizin nach wissenschaftlich gewonnenen Erkenntnissen und Daten sowohl bei der Erstellung der Diagnose als auch beim Therapievorschlag praktizieren muss.
Oberste französische Gesundheitsbehörde: Erneute Evaluation der Studienlage zur Homöopathie (2019)
Insgesamt zeigten keine belastbaren Studien die Überlegenheit homöopathischer Arzneimittel gegenüber konventionellen Behandlungen oder dem Placebo in Bezug auf die Wirksamkeit.
Zentrale Ärztekammer der Region Madrid (ICOMEM)
„Über homöopathische Produkte: [Die Ärztekammer …] sieht es insofern als unethisch an, dass Methoden, aber auch Verschreibungen von Arzneimitteln als wirksame Therapien dargestellt und vorgeschlagen werden, bei denen wissenschaftliche Grundlagen fehlen, denen illusionäre Vorstellungen zugrunde liegen oder die sich praktisch unzureichend bewährt haben.
Aus diesen Gründen wird die Verantwortung des Arztes öffentlich eingefordert und an seine Pflichten gegenüber dem Patienten und dem Berufsstand gegenüber erinnert.
Was den europäischen Bereich betrifft, so ist – abgesehen natürlich von den Ländern, bei denen Homöopathie in den Gesundheitssystemen ohnehin keine Rolle spielte – Deutschland das einzige Land, das nach der Veröffentlichung des als Empfehlung an die Regierungen und die EU-Kommission gedachten Statements zur Homöopathie keinerlei Veränderungen im Arzneimittel- und Sozialrecht vorgenommen hat. Damit kann mit Fug und Recht festgehalten werden, dass Deutschland in dieser Hinsicht die europäische „Rote Laterne“ innehat – hinten am letzten Waggon mit der Bremsanlage.
III
Gesundheitspolitische / staatliche Maßnahmen
zur Homöopathie im Gesundheitswesen
USA – Federal Trade Commission (US-Verbraucherschutzbehörde) – 2016
Die FTC fordert in einem „Enforcement Policy Statement on Marketing Claims for OTC Homeopathic Drugs“ vor dem Hintergrund, dass ein Vertrieb als Arzneimittel ohne Evidenznachweise nicht hingenommen werden könne, eindeutige Kennzeichnungen von homöopathischen Präparaten.
Statements der zugehörigen Pressemitteilung:
„Diese Irreführung der Kunden (Verkauf als Arzneimittel ohne wissenschaftlichen Wirkungsnachweis) könne dadurch beseitigt werden, dass die Hersteller in ihren Begleitmaterialien („marketing materials“) angeben, dass es
- keine wissenschaftlichen Belege dafür gäbe, dass das Produkt wirkt und dass sich
- die Angaben lediglich auf die Theorien der Homöopathie, die aus dem 18. Jahrhundert datieren, abstützen, die von den meisten modernen medizinischen Fachleuten nicht akzeptiert werden.“
Russische Föderation, Russische Akademie der Wissenschaften / Gesundheitsministerium – 2017
Die „Kommission zur Bekämpfung von Pseudowissenschaften“ am Präsidium der Russischen Akademie der Wissenschaften (RAS) hat 2017 ein Memorandum „Über die Pseudowissenschaft Homöopathie“ herausgegeben. Die RAS hat auf der Grundlage eines interdisziplinären Fachgutachtens die Homöopathie als Pseudomedizin eingestuft und erklärt, dass künftige Erkenntnisse, die dies revidieren könnten, nicht zu erwarten sei (deutsche Übersetzung hier). Die Homöopathie soll aus allen Ebenen des öffentlichen Gesundheitswesens entfernt werden. Als Maßnahmen wurden dem Gesundheitsministerium zur Umsetzung u.a. vorgeschlagen:
- […] Die postgraduale Ausbildung zukünftiger Ärztinnen und Ärzte hat darauf abzuzielen, diese mit den Grundannahmen pseudowissenschaftlicher Methoden – einschließlich Homöopathie – und der Kritik daran, die zur Einstufung als Pseudowissenschaft führt, vertraut zu machen.
- Versicherungen haben sich an die gängige Praxis zu halten, die keine Leistungserbringung für Homöopathie vorsieht.
- Kein gleichberechtigter Apothekenverkauf von Arzneimitteln und homöopathischen Präparaten. Homöopathische Medikamente sollten in einer separaten Vitrine vorgehalten werden.
- Keine Beratung von Patienten mehr zu homöopathischen Mitteln. Pflichtberatung in Apotheken bei Patienten, die homöopathische Mittel verlangen, dahingehend, dass die Homöopathie nach wissenschaftlichen Kriterien keinen Wirkungsnachweis erbringen konnte.
- Verpflichtung der Ärzte zur Information von Patienten über die Wirkungslosigkeit der Homöopathie und ihre Einstufung als Pseudomedizin. Keine Zusammenarbeit mit Organisationen, die weiterhin Homöopathie fördern und verbreiten. Eine Verschreibung homöopathischer Mittel ist als unethisch anzusehen, und zwar auch dann, wenn nur der Placebo-Effekt erreicht werden soll. […]
Australien, Gesundheitsministerium und Verband der Versicherungsanbieter / Pharmaceutical Society of Australia) – 2017
Homöopathie wurde bislang nur innerhalb von privaten Zusatzmodulen zur gesetzlichen Krankenversicherung angeboten. Das australische Gesundheitsministerium und die Versicherungsträger haben sich 2017 darauf geeinigt, Homöopathie-Erstattungen (neben anderen Methoden ohne Wirkungsnachweis) auch im Bereich der privaten Zusatzversicherung nicht mehr zuzulassen. Damit wurde einer Empfehlung des Royal Australian College of General Practitioners (der Allgemeinärzteorganisation Australiens) als Konsequenz aus dem NHMRC-Review von 2015 gefolgt. Die Entscheidung wurde 2019/20 nochmals evaluiert und blieb unverändert.
Gesundheitsministerium und Apothekerverband haben als Fazit einer gemeinsamen Begutachtung erklärt, dass „diese Produkte (Homöopathika) keine Evidenzbasis hätten und ausreichende Beweise für ihre Nichtwirksamkeit bestünden, um aus ethischen Gründen ihren Verkauf in öffentlichen Apotheken auszuschließen. Die Pharmaceutical Society of Australia und andere Berufsvereinigungen haben ergänzend erklärt, dass sie den Verkauf und das Vorhalten von Homöopathika in öffentlichen Apotheken nicht unterstützen.
Nachtrag: Inzwischen hat sich dies im offiziellen PSA Code of Ethics for Pharmaceutics niedergeschlagen. Aufgrund dessen hat die PSA nun Werbetreibenden und Einkaufsgemeinschaften des pharmazeutischen Bereichs dringend empfohlen, in keiner Form für Homöopathika zu werben.
Vereinigtes Königreich, National Health Service – 2017
Der National Health Service (NHS), der Träger des Gesundheitssystems in Großbritannien, hat die Verschreibungsfähigkeit von Homöopathika (und 17 weiteren Mitteln, durchweg pflanzliche Remedia) beendet. Die Regionalorganisationen des NHS erhielten entsprechende „Blacklists“. Der Schritt erfolgte wegen „geringer klinischer Wirksamkeit“ und/oder „geringer Kosteneffizienz“. Speziell die Homöopathie sei „im besten Fall Placebo”.
Der NHS folgt damit einer bereits aus dem Jahre 2009 stammenden Empfehlung des Science and Technology Committee des House of Commons: „Homeopathy should not be funded on the NHS and the MHRA should stop licensing homeopathic products… We conclude that the Government’s policies on the provision of homeopathy through the NHS and licensing of homeopathic products are not evidence-based“).
Spanisches Gesundheitsministerium – 2017
Die spanische Gesundheitsministerin hat den Regionen per Erlass die Erstattung von Homöopathie im Krankenversicherungssystem ausdrücklich untersagt und wiederholte Verstöße der Regionen gegen die entsprechende bisherige Weisung gerügt. Noch bestehende Genehmigungen für Homöopathika-Erstattungen in der Region Valencia (nach dem sog. Königl. Dekret 1/2015) wurden zurückgezogen.
Food and Drug Administration, USA – 2017
Die Food and Drug Administration (FDA), die US-amerikanische Arzneimittelbehörde, hat in einer Pressemitteilung vom 18.12.2017 erstmals Regulationsvorschriften für den Vertrieb und Verkauf von Arzneimitteln ohne Wirkungsnachweis, insbesondere der Homöopathie, angekündigt. Sie erkennt damit ausdrücklich die Risiken an, die damit verbunden sind, dass Patienten Mitteln ohne Wirkungsnachweis auch bei schwereren Erkrankungen vertrauen könnten. Aus der Pressemitteilung:
„Bis vor relativ kurzer Zeit war die Homöopathie ein kleiner Markt für Spezialprodukte. Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist der Markt für homöopathische Arzneimittel exponentiell gewachsen. Dies hat eine Industrie mit einem Volumen von fast 3 Milliarden US-Dollar hervorgebracht, was entsprechend mehr Patienten den potenziellen Risiken aussetzt, die mit der Verbreitung von unbelegten, nicht getesteten Produkten und unbegründeten gesundheitsbezogenen Angaben verbunden sind. […]
Der Leitlinienentwurf ist ein wichtiger Schritt in der Arbeit der Agentur zum Schutz der Patienten vor unbewiesenen und potenziell gefährlichen Produkten. […]“
Schweiz – Einführung der Erstattungsfähigkeit von Homöopathie als „politischer Kompromiss“ ohne Wirksamkeitsnachweis – 2017
Die Situation in der Schweiz stellt einen Sonderfall dar. Derzeit ist die allgemeine Krankenversicherung ermächtigt, Kostenerstattungen für fünf „komplementärmedizinische Methoden“ (darunter die Homöopathie) zu leisten. Dies geschieht jedoch nicht aufgrund von Evidenznachweisen.
Parallel zu einer ersten „probeweisen“ Einführung der Kostenerstattung für fünf „komplementäre“ Methoden (darunter Homöopathie) wurde 1999 in der Schweiz ein Programm zur Evaluation gestartet, von dem die zukünftige Handhabung abhängen sollte (PEK – Programm Evaluierung Komplementärmedizin). Bezüglich der Homöopathie führte dieses Programm zu der unter I.5 gelisteten Studie Shang et al. Diese erbrachte (ebenfalls) keinen belastbaren Wirkungsnachweis für die Homöopathie (sie verursachte jahrelang massive Kontroversen in der Fachwelt, ist bis heute noch Gegenstand von Diskussionen, die Richtigkeit der Gesamtaussage konnte jedoch niemals erschüttert werden). Daraufhin wurde die Erstattungsfähigkeit der fünf Verfahren – einschließlich der Homöopathie – in der Schweiz wieder beendet.
Per Volksentscheid „Für den Erhalt von Komplementärmedizin“ wurde dessen ungeachtet erreicht, die Komplementärmedizin als Teil der Gesundheitsfürsorge in der schweizerischen Verfassung zu verankern. Die Umsetzung dieser Entscheidung nahm erhebliche Zeit in Anspruch und endete in einem politischen „Kompromiss“: In einem „Vertrauensbonus“ für die Komplementärmedizin. Ungeachtet der nach wie vor nicht belegten Evidenz der Wirksamkeit werden seit dem 01.07.2017 pauschal die in Rede stehenden fünf Therapien in den Leistungskatalog aufgenommen und erst dann, wenn Ärzte- oder Patientenorganisationen einen Antrag auf Überprüfung stellen, sollen diese im Einzelfall „auf ihren therapeutischen Nutzen“ untersucht werden.
Die derzeit bestehende Kostenerstattungsfähigkeit für Homöopathie im Schweizer Gesundheitssystem ist also keineswegs ein Beleg für eine anerkannte Evidenz der Methode, wie oft und gern behauptet wird. Die derzeitige Situation in der Schweiz ist mit den Ergebnissen der eigenen Evaluation (Arbeit Shang et al.) unvereinbar.
Die ganze Geschichte dieses langjährigen Prozesses beschreibt das Informationsnetzwerk Homöopathie hier.
Die Neue Zürcher Zeitung hat zu den wiederholten Versuchen deutscher Homöopathie-Organisationen, das „Schweizer Modell“ als Beleg pro Homöopathie darzustellen, einen umfassenden klarstellenden Artikel veröffentlicht.
Spanisches Gesundheitsministerium – 2018
Die spanische Gesundheitsministerin hat sich im Interview mit La Vanguardia , klar zur Homöopathie als Pseudowissenschaft positioniert:
„Die Homöopathie ist eine „alternative Therapie“, die wissenschaftlich nicht belegt ist.
…
Gesundheitseinrichtungen haben die Pflicht, Produkte mit nachgewiesener Wirkung zu verwenden, d.h. Medikamente, die strengen klinischen Studien und Kriterien unterzogen wurden. Wenn homöopathische Arzneimittel wissenschaftliche Nachweise erbringen, werden sie als solche angesehen. Das ist nicht mehr der Fall.
…
Wir arbeiten mit dem Wissenschaftsministerium an einer Strategie zur Bekämpfung der Pseudowissenschaften. Sobald diese Strategie vorliegt, werden wir Maßnahmen zu einzelnen Methoden / Mitteln vorlegen, aber es ist klar, dass es vordringlich ist, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und aufzuzeigen, welche Produkte für die Gesundheit nützlich sind und welche nicht, und den Schaden zu erklären, den die Entscheidung für eine alternative Therapie anrichten kann.“
Ungarisches Nationales Institut für Pharmazie und Lebensmittelgesundheit (OGYÉI) – 2020
„Ab dem 1. Juli (2020) darf ein homöopathisches Arzneimittel nur dann mit einer therapeutischen Indikation vermarktet werden, wenn die Wirksamkeit der Behandlung durch klinische Studien bestätigt wurde. Solche Mittel existieren derzeit jedoch nicht.
Ab dem Stichtag können homöopathische Arzneimittel nur in Ungarn ohne “therapeutische Indikation” vermarktet werden, da ihre Indikation für die auf dem Markt befindlichen Produkte durch eine klinische Studie nicht bestätigt wurde.
Die Werbung für marktfähige homöopathische Arzneimittel wird daher ab dem 1. Juli 2020 möglicherweise nur noch den Etikettentext des Produkts und keine zusätzlichen Informationen enthalten.“
Durch die Änderung des Gesetzes zur Änderung der Rechtsvorschriften über Humanarzneimittel und anderer Rechtsvorschriften zur Regulierung des Pharmamarkts (in Kraft getreten zum 01.01.2020) hat Ungarn das Zulassungsregime für homöopathische Mittel, die mit einer Indikation auf den Markt kommen wollen, verschärft. Solche Mittel müssen nun ausnahmslos mit klinischen Studien auf wissenschaftlicher Basis ihre Wirksamkeit nachweisen. Die zum Stichtag auf dem Markt befindlichen Mittel mit Indikation genießen keinen Bestandsschutz. Im Ergebnis ist nach dem 01. Juli 2020 in Ungarn kein homöopathisches Mittel mehr auf dem Markt, das mit einer Indikationsangabe versehen ist oder werben darf.
In Deutschland würde dies einer Abschaffung des Kerns des Binnenkonsens entsprechen, indem der Kommission D beim BfArM die Möglichkeit genommen würde, indikationsbezogene Zulassungen auf der Grundlage „homöopathischen Erkenntnismaterials“ nach selbstgesetzten Kriterien auszusprechen.
Die Zusammenstellungen unter II und III erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.