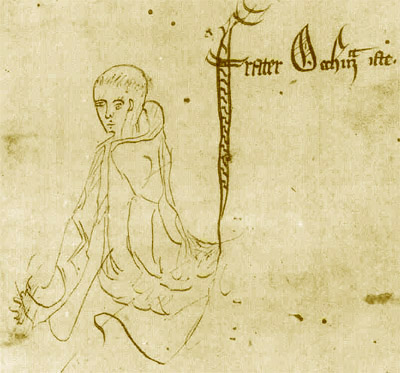“Wissenschaftspluralismus” und “Wissenschaftsdogmatismus”
Dass die Vertreter der Homöopathie-Lobby den Kritikern mit dem Vorwurf eines „Wissenschaftsdogmatismus“ begegnen und ihre Pro-Homöopathie-Positionen mit einem vorgeblichen Anspruch auf „Wissenschaftspluralismus“ legitimieren wollen, ist nicht neu. Wobei „Wissenschaftspluralismus“ nicht allein den Anspruch artikuliert, „mehrere Medizinen“ als „pluralistisch“ anzuerkennen, sondern darüber hinaus den, gleich „mehreren Wissenschaften“ eine gleichberechtigte Existenz zusprechen soll.
Dieser „Wissenschaftspluralismus“ ist ein überholtes Konzept aus den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, das wissenschaftstheoretisch nie haltbar war und von kritisch-rationalen Konzepten wie der evidenzbasierten Medizin endgültig als Oxymoron, als Systemwiderspruch in sich, entlarvt wurde. “Wissenschaftspluralismus” – ein Begriff, der gern und oft vom damaligen Ärztepräsidenten Hoppe zur Rechtfertigung seiner Idee vom “Besten aus allen Welten” zitiert wurde. Schon damals eine Fehlvorstellung, denn die Wissenschaft ist “eine Welt”, die sich einig ist in dem Bestreben, Erkenntnisgewinn zu schaffen und keineswegs toleriert, belegbare Erkenntnis mit überkommenen Vorstellungen (“Traditionen”) in einen Topf zu werfen und dabei laut “Pluralismus” zu rufen.
Man bedenke, dass das Konzept des auf konstruktivem Zweifel basierenden kritischen Rationalismus zu den Zeiten Hoppes, den 1980er / 1990er Jahren des vorigen Jahrhunderts, längst weltweit als Basis des Wissenschaftsbegriffs etabliert war. Versuche, dies für die Medizin zu relativieren, hieß schon damals, die Zeit zurückdrehen zu wollen. Zumal die Wissenschaft, insbesondere die Evidenzbasierte Medizin, selbst höchst pragmatisch ist – es kommt ihr nur auf die Validität ihrer Erkenntnisse an, nicht auf deren Herkunft oder auf die Methodik der Beweisführung. Wo sollte da Platz für irgendeinen “Pluralismus” sein? In Diskussionen weichen deren Vertreter gern auf “Methodenpluralismus” aus, womit sie allerdings nur meinen, dass der kritische Rationalismus eben nur eine “Methode” unter vielen sei. Was so simpel nicht ist – der kritische Rationalismus in der heutigen Ausprägung ist das Ergebnis von mehr als 2000 Jahren Bemühens um die Frage, was wir wissen können und wie wir dahin gelangen. Er ist unsere bislang beste Lösung, um trotz des im Kern unlösbaren Induktionsproblem Annäherungen an Wahrheit und Wirklichkeit zu erreichen.
Im Grunde schimmert hier an allen Ecken und Enden das Traditionsargument hinter der Folie neomystischer Vorstellungen durch. Dass die Homöopathie-Lobby diese Vorstellungen nach wie vor hochhält, ist aus ihrer Sicht zweifellos verständlich. Sie ist ja in den 1970er Jahren unter dieser Flagge wiederbelebt worden, als Kind der New-Age-Ära und des Neomystizismus. Das hat sie aber nicht richtiger werden lassen.
“Der andere könnte auch recht haben”
Nun haben die Homöopathen Verbündete in dem Wunschdenken gefunden, einen ihnen genehmen Wissenschaftsbegriff zu schaffen: Das „Dialogforum Pluralismus in der Medizin“, ein Überbleibsel aus der Hoppe-Zeit, macht sich in einer Veröffentlichung gemeinsam mit Vertretern der Homöopathie-Lobby ausgerechnet am Beispiel der Homöopathie stark für „Wissenschaftspluralismus“ und gegen „monoparadigmatischen Reduktionismus“ (ein diffamierendes Begriffsgeklingel). Unter der Überschrift “Der andere könnte auch recht haben.” Darin werden allgemeine Positionen zum Thema Wissenschaftlichkeit mit den ständig wiederholten Behauptungen der Homöopathen, ihre Methode sei valide und wissenschaftlich begründet, zu einer beinahe undefinierbaren Melange zusammengerührt. Der Teaser:
In Anbetracht zahlreicher Pauschalangriffe auf die Komplementärmedizin und insbesondere auf die Homöopathie sowie einem „Münsteraner Memorandum Homöopathie“ (1), in dem die Abschaffung der ärztlichen Zusatzbezeichnung Homöopathie auf dem 121. Deutschen Ärztetag gefordert wird, erfolgt im Namen der Mitglieder des Dialogforum Pluralismus in der Medizin (DPM) sowie der unten aufgeführten Institutionen und der unterzeichnenden Personen eine Stellungnahme, in der dargelegt wird, dass die Behauptung der Unwirksamkeit der Homöopathie im Hinblick auf die publizierte wissenschaftliche Evidenz nicht zutrifft (2-7 u.a.m.). Die folgende Richtigstellung erfolgt mit einem Verweis auf internationale repräsentative klinische Studien, Meta-Analysen und HTAs zur Homöopathie (8-20).
Bedarf es noch näherer Ausführungen zur Unhaltbarkeit dieser mit großer Geste vorgetragenen Behauptungen? Angesichts dessen, was in den letzten zwei Jahren intensivierter wissenschaftsfundierter Homöopathiekritik erschienen ist und belegt wurde und angesichts der weltweiten Verdikte gegen die Homöopathie von großen wissenschaftlichen Vereinigungen, Instituten und staatlichen Stellen ist dies nicht mehr als das bekannte Rufen der Homöopathen im Wald – diesmal mit Unterstützung durch den Gastchor der Wissenschaftspluralisten. Die angeführten Belege – wen wundert es – sind eine Aufzählung längst widerlegter Scheinbeweise.
“Der Andere könnte auch Recht haben“. Was soll man darunter nun verstehen? Eine Trivialität? Eine im Zusammenhang mit objektiver Erkenntnisgewinnung kaum zu unterbietende Plattitüde? Nein, viel schlimmer.
Bei diesem dem Ganzen übergeordneten “Motto” handelt es sich um ein Zitat des Philosophen Hans-Georg Gadamer, das ihm oft als eine Art Fazit seiner Lebenserkenntnis zugeschrieben wird. Gadamer war aber kein Naturwissenschaftler und seine Sentenz hat mit den Methoden des Erkenntnisgewinns in den empirischen Wissenschaften (Karl Poppers Falsifikationismus) nicht das Geringste zu tun. Gadamer hat selbst oft klargestellt, dass seine Wissenschaft mit den empirischen Wissenschaften und vor allem mit Poppers Erkenntnisbegriff keine Schnittmengen hat. Die Sentenz steht im Kontext von Gadamers Forschungsgebiet der philosophischen Hermeneutik, der Erkenntnisgewinnung beim “Verstehen” von Texten, Kunst- und Bauwerken oder des Gegenübers in einem Gespräch. Gadamer weist darauf hin, dass dieses Verstehen stets sprach- und zeitgebunden ist (“Das setzt beim Interpretieren von Werken Offenheit, das Bewusstmachen der eigenen Vorurteilsstruktur sowie die Bereitschaft zum Gespräch bzw. zu reflexivem Auseinandersetzen voraus”). Gadamer bewegt sich ausschließlich in geisteswissenschaftlichen Kategorien.
Ihn und sein Zitat in den Kontext der Frage zu stellen, ob Homöopathie naturwissenschaftlich begründbar sei und ob sie Evidenz für sich in Anspruch nehmen könne, ist nicht nur grotesk, es ist von Seiten akademisch gebildeter Menschen eine intellektuelle Unredlichkeit ersten Ranges. Natürlich hört sich das gut an, natürlich kommt Gadamers Forderung nach Offenheit und Vorurteilsfreiheit den Apologeten irgendwie entgegen – aber sie begehen hier einen unverzeihlichen Kategorienfehler, der allein ausreicht, um das Statement des “Dialogforums” wissenschaftlich zu delegitimieren. Gadamer bewegt sich im Bereich der Kategorisierung des Subjektiven – Popper in der Sphäre des intersubjektiven Erkenntnisgewinns.
(Mehr zum fundamentalen Unterschied von Gadamers hermeneutischem “Der andere könnte auch Recht haben” und Karl Poppers Position in “Giuseppe Franco (Eichstätt): Der kritische Rationalismus als Herausforderung für den Glauben. Ein Gespräch mit Hans Albert über Glauben, Wissen und Gadamers Hermeneutik. Aufklärung und Kritik 1/2006, http://www.gkpn.de/franco_albert.pdf)
Geht es überhaupt um “Recht haben” in der empirischen Wissenschaft? Nein. Es geht darum, objektiver Erkenntnis (der Wirklichkeit) so nahe wie möglich zu kommen, Wahrscheinlichkeitswerte für die Frage zu gewinnen, wie belastbar Erkenntnisse als Annäherung an die “Wirklichkeit” sind. Und zwar auf dem Wege ständiger Infragestellung, der Popperschen Falsifikation. Das hat mit “Recht haben” überhaupt nichts zu tun. Und entlarvt nur den Ärger der Homöopathie-Proponenten darüber, dass ihnen die kritisch-rationale Methode der empirischen Wissenschaften keine Bestätigung für ihre Positionen liefert. Q.e.d. Und wie soll man es bewerten, wenn auf der einen Seite die kritisch-rationale Methode durch die Berufung auf Gadamer negiert wird und man sich andererseits gleichzeitig auf sie stützt, wenn man bemüht ist, der Homöopathie Evidenz zuzuschreiben?
Und ja, auch Popper wird die Sentenz vom anderen, der auch Recht haben könne, zugeschrieben. Der Kontext, in dem er dies geäußert hat, passt aber nun erst recht nicht auf die „wissenschaftspluralistische“ Position. Denn er meinte – viel einfacher als Gadamer – damit schlicht sein Falsifizierungsprinzip als solches, sein Gebot, dass man gefundene Forschungsergebnisse als erstes selbst nach Kräften in Frage stellen müsse, bevor man sich der Kritik der Wissenschaftsgemeinschaft stelle.
Ethische Entgleisungen
Nun könnte man das – so ärgerlich wie es auch ist – als Verirrung Ewiggestriger abtun. Ernst wird die Sache aber, wenn im Verlaufe des Artikels schwerste moralische Geschütze gegen die aufgefahren werden, die solchen Vorstellungen der Begründung von Beliebigkeit nicht folgen, sondern den Weg des objektiven Erkenntnisgewinns weitergehen wollen. Allen Ernstes wirft man diesen, also den Vertreteren einer kritisch-rational begründeten Wissenschaftlichkeit, „totalitäre Tendenzen“ und damit einen Verstoß gegen grundgesetzlich garantierte Freiheitsrechte vor:
„Ein monoparadigmatischer Reduktionismus führt aber – bedacht oder nicht bedacht – am Ende stets in eine totalitäre Ideologie, für die die dogmatische Ideologie alles, der Respekt vor dem Selbststimmungsrecht des Bürgers und der Achtung der Menschenwürde und des individuellen Erkenntnisstrebens nichts bedeutet. Wollen wir eine solche durch totalitäre Strukturen geprägte Entwicklung in unserem Land für die Medizin und das Gesundheitswesen?“
Was sich hier manifestiert, ist eine unheilige Allianz. Eine Allianz zwischen den Fossilien aus der Hoppe-Ära, die nicht wahrhaben wollen, dass ihre These vom “Besten aus beiden Welten” durch die pragmatische evidenzbasierte Medizin ebenfalls als Kategorienfehler entlarvt wurde und den Homöopathen andererseits, denen so etwas natürlich sehr entgegenkommt. Die haben ähnliches längst im Alleingang versucht. So haben z.B. Walach und Baumgartner offen einen eigenen Wissenschaftsbegriff für die Homöopathie eingefordert. Wenn das kein Ruf nach Beliebigkeit ist – der in der besprochenen Veröffentlichung auch noch aufs Perfideste in einen Moralvorwurf gegen die “andere Seite” umgedeutet wird…
Im Grunde ist es ein Angriff auf über 2000 Jahre des Bemühens um menschliche Erkenntnisgrundlagen. Hier wird der schlichte Satz negiert, dass Erkenntnis eine nachweisbar begründbare Aussage sein muss. “Der Andere könnte auch Recht haben” – Gadamer wäre entsetzt, seine Sentenz im vorliegenden Zusammenhang missdeutet zu sehen. Popper erst recht.
Natürlich darf auch das Autoritätsargument nicht fehlen (immer gut, wenn man sonst nichts zu bieten hat). Aber erstens ist so etwas immer schwach und zweitens immer misstrauisch zu betrachten – traue keinem Autoritätsargument, dessen Validität du nicht selbst geprüft hast! Hier wird der Physiker und bedeutende Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn als Zeuge bemüht; aufmerksame Leser dieses Blogs sind Kuhn sicher schon einmal begegnet. Sein Begriff des “Paradigmas” wird für die Zwecke der Autoren ausgeschlachtet. Aber, ohne in die Tiefe zu gehen: Man mag über Thomas S. Kuhns Paradigmenbegriff streiten können, zumal er selbst diesen im Laufe der Zeit vielfach umdefiniert und abgewandelt hat und er sogar von seinen Exegeten höchst unterschiedlich gedeutet wurde und wird.
Was aber hier geschieht, ist geradezu abenteuerlich. Kuhn bewegte sich stets auf dem Boden der kritisch-rationalen Methode und dachte im Traum nicht daran, sie in Frage zu stellen. Die Berufung auf ihn in dem inkriminierten Artikel tut aber etwas ganz Erstaunliches: Sie versucht, die kritisch-rationale Methode sozusagen Kuhns Paradigmenbegriff als eine Teilmenge unterzuordnen. Daraus soll eine Art “Unverbindlichkeit” des kritisch-rationalen Wissenschaftsbegriffs abgeleitet werden, mit der Folge, dass ein Paradigmenwechsel in Kuhns Sinne auch eine Abkehr von der kritisch-rationalen Methode sein könnte. Das ist grotesk. Nichts anderes aber tut dieser verzweifelte Rundumschlag der Vertreter der Prämoderne. Kuhn wäre entsetzt gewesen über die Verzerrung des Erkenntnisbegriffs in seinem Namen.
Bei der Veröffentlichung des “Dialogforums” handelt es sich aber eben auch um eine ethische Entgleisung, die eigentlich selbstdisqualifizierend ist, um den Versuch einer Diskreditierung des international im Konsens stehenden Begriffs der Wissenschaftlichkeit. Ein Tritt gegen über 2000 Jahre ernsthaftes Bemühen um valide Erkenntnisse über unsere Welt und redliches Vorgehen dabei. Der Versuch einer Legitimierung des Kontrafaktischen.
All das akzeptiert und verbreitet von deutschen Hochschullehrern. Mehr dazu zu sagen, hieße, dieser Fehlleistung allzu viel Ehre anzutun.
Zum Weiterlesen sehr zu empfehlen ist diese Gegenposition von Joseph Kuhn bei den scienceblogs.
Bildnachweis: Pixabay, Creative Commons Lizenz CC0