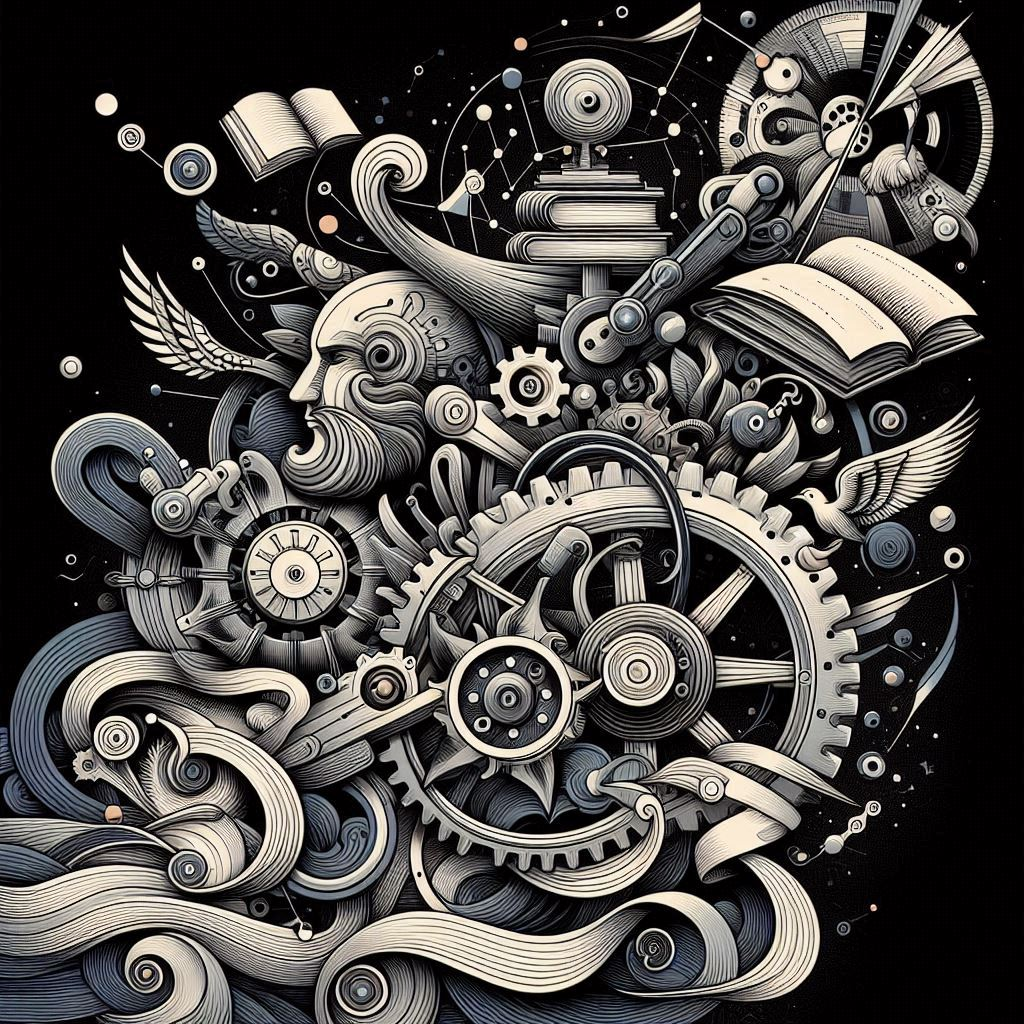Was mit Foucault als Kritik an der institutionellen Erzeugung von Wahrheit begann, wurde bei Lyotard zur Erosion des gemeinsamen Bezugsrahmens – und bei Derrida zur Demontage der sprachlichen Grundpfeiler jeglicher Objektivität. Mit Butler erreicht diese Linie ihren politisch wirkmächtigsten Punkt: Sprache, Macht und Identität verschmelzen zur performativen Realität – und der erkenntnistheoretische Relativismus wird zur sozialen Norm.… Weiterlesen ...